EINFÜHRUNG
Zum AnfangEDDERSHEIM IM SOMMER 1990
700, 725, 875, 880... ... JAHRE EDDERSHEIM
Diese Worte richtete Bürgermeister Alfred Schubert am
3. August 1990 an die zahlreich in der Turnhalle der Grund-
schule Eddersheim erschienenen Gäste. Anlass war die
große Auftaktfeier zu einem besonderen Stadtteiljubiläum.
Ganze zehn Tage zelebrierte man im Sommer vor 35 Jahren in Eddersheim mit einem bunten Programm das 700. Jubiläum der urkundlichen Ersterwähnung des ehemaligen Fischer-
dorfes. Die Feierlichkeiten gipfelten schließlich in einem historischen Festzug zum Fischerfest mit anschließendem großen Feuerwerk.
Damals war man noch davon ausgegangen, Eddersheim sei am 9. Mai 1290 erstmals namentlich in einem Dokument genannt worden. Erzbischof Gerhard von Mainz war es, welcher gemeinsam mit dem Mainzer Domdekan Gebhard eine Urkunde siegelte, in welcher Letzerwähnter testa-
mentarisch alle Güter im Dorf Flörsheim, die zuvor einem gewissen Arnold aus Edirsheym gehört hatten, für einen
zu Ehren der Apostel Peter und Paul zu errichtenden Altar stiftete.
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE EDDERSHEIMS
ERSTE SIEDLUNGSSPUREN
ERSTE SIEDLUNGSSPUREN


von Gefäßen aus der Michelsberger Kultur, eine Steinaxt aus der Zeit der Schnurkeramik oder ein aus der Bronzezeit stammender Bronzedolch.
Auch die Chatten, so wird vermutet, könnten hier ansässig gewesen sein.
Spätestens seit römischer Zeit scheint das Areal um Eddersheim recht konstant besiedelt gewesen zu sein. Übergänge an Flüssen und Straßen-
kreuzungen sind seit jeher prädestinierte Siedlungs- und Militärstandorte.
Hier kreuzten sich vermutlich zwei bedeutende Straßen: Eine soll in Nord-
Süd-Richtung vom Römerlager bei Hofheim her mit einer Furt über den
Main geführt haben; eine weitere von Mainz-Kastell nach Höchst. Objekte
aus jener Zeit finden sich beiderseits des Mains.
So entdeckte man etwa im Wasserwerkswald eine Münze aus Bronze mit dem Bildnis des Kaisers Augustus, welcher von 63 v. Chr. bis 14 n. Chr. gelebt hat. Mancher Lokalhistoriker vermutet, dass es in Eddersheim sogar ein Heerlager gegeben haben könnte oder dass Eddersheim zumindest zur Versorgung eines solchen in der Umgebung gedient haben könnte. Ein Nachweis hierüber konnte bisher jedoch nicht geführt werden.

ORTSGRÜNDUNG
EIN FRANKE NAMENS ETHER?
EIN FRANKE NAMENS ETHER?


Gründung
Die Gründung eines festen Ortes wird in die Zeit vom 5. bis zum 7. Jahrhundert datiert. Die Endungssilbe "-heim" lässt vermuten, dass Eddersheim im Zuge der Fränkischen Landnahme als Dorf entstand. Grabfunde aus jener Zeit auf Eddersheimer Gemarkung stützen diese Annahme.
Name
Seinen Namen könnte Eddersheim somit einem fränkischen Edlen namens Ether verdanken. Der Ortsname könne allerdings auch auf eine Befestigung verweisen, welche das Dorf früher umgab: Ein Zaun mit Eddern (= Pfählen).
Wappen
Letztere These wird auch bei der Deutung des Eddersheimer Wappens herangezogen, welches gesichert 1658 erstmals genutzt wurde und sich
auch als Gerichtssiegel und auf Grenzsteinen wiederfindet.
Das Wappen zeigt senkrecht eine Wolfsangel, welche durch einen Ring führt. Dieses Symbol kann unterschiedlich gedeutet werden. Zum einen wurden diese Angeln früher als Jagdgeräte für Wölfe verwendet, zum anderen als Mauerhaken etwa für den Bau von Befestigungsanlagen. Darüber hinaus steht die Wolfsangel symbolisch für eine geregelte Forstwirtschaft. Der im Wappen abgebildete Ring könnte wiederum als Hinweis auf eine Dorfbefestigung verstanden werden.

JAHRHUNDERTE UNTER WECHSELNDER HERRSCHAFT
TERRITORIAL- UND HERRSCHAFTSGESCHICHTE
Zeit hier welche Rechte ausgeübt hat, ist erst ab der
Frühen Neuzeit zunehmend fassbar.
Die Rechtsordnung war lange Zeit pluralistisch
angelegt, was immer wieder zu Konflikten zwischen
den unterschiedlichen Rechteinhabern am Ort führte.
Sogenannte Weistümer, urkundliche Festschreibungen
von Rechtsgewohnheiten, dokumentieren als Quellen
die Rechtsverhältnisse am Ort.
Von den Römern zu den Franken
Unter römischer Herrschaft gehörte Eddersheim zum Verwaltungsbezirk civitas mattiacorum, welcher auch
das Gebiet des heutigen Hattersheims umfasste.
Man geht heute davon aus, dass dieses Gebiet zunächst in einem alemannischen und hierauf folgend in dem fränkischen Verwaltungsbezirk Königssondergau aufging.
Dessen Verwaltung lag in der Hand eines Gaugrafen, dessen Hof, curtis genannt, sich in der Nähe des heutigen Wiesba-
dener Stadtschlosses befand. Die Einkünfte aus dem Gau wurden durch die fränkischen Könige vereinnahmt.
Viel Konkretes ist aus den ersten Jahrhunderten um die und nach der Ortsgründung Eddersheims nicht überliefert. Im Laufe des Frühmittelalters entwickelte sich der Ort vermutlich zu einem Haufendorf mit mehreren Gehöften, welche durch einen Zaun und/ oder einen Graben umgeben waren. Es gab zwei befestigte Pforten: Eine Unterpforte am Main und eine Oberpforte am oberen Ende der heutigen Propsteistraße.
MAINZER HERRSCHAFT SEIT DEM SPÄTMITTELALTER
MAINZER HERRSCHAFT SEIT DEM SPÄTMITTELALTER


Ab dem 13. Jahrhundert kam Eddersheim nach und nach unter die Herrschaft der Mainzer Dompröpste. Ein Zeugnis deren zunehmenden Einflusses ist der seit dem 14. Jahrhundert nachweisbare Dompropsteihof. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts gehörte schließlich das Dorf mitsamt allem Grundeigentum zur Dompropstei.
Die Gerichtsbarkeit am Ort hatten lange Zeit die Herren von Eppstein,
später Eppstein-Königstein, als Vögte inne. In den Jahre 1535 bis 1581 kam
die Gerichtsbarkeit kurzzeitig zu den Grafen von Stolberg-Königstein.
Mit dem Aussterben der männlichen Linie fiel diese Grafschaft vollständig an den Mainzer Erzbischof, sodass ab diesem Zeitpunkt alle hoheitlichen Rechte in Eddersheim beim Erzbistum lagen. Unter Mainzer Herrschaft soll das Dorf einen beträchtlichen Aufschwung erlebt haben.

VON KRISENZEITEN ZUM WIEDERAUFBAU
DAS 17. JAHRHUNDERT
DAS 17. JAHRHUNDERT


Noch bevor die Herrschaft der Mainzer Dompröpste ihre volle Wirkung in Eddersheim entfalten konnte, hatte das Dorf – wie das Heilige Römische Reich an sich – eine
Reihe von Krisenjahren
zu durchleben.
Neben den Auswirkungen der Kleinen Eiszeit war
es insbesondere auch die Reformation, welche ab dem frühen 16. bis ins 17. Jahrhundert wirkte und einherging mit der Auflehnung unterer Schichten gegen die ökonomischen und politischen Privilegien von Adel und Klerus (Stichwort: Bauernkriege). Zugleich war sie ein Faktor, welcher schließlich
zum Ausbruch eines großen Krieges um den richtigen Glauben, Territorialherrschaften und die Hegemonie in ganz Europa führte.
Der Dreißigjährige Krieg
Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) war von epochaler Bedeutung.
Auch wenn dieser, wie viele andere Krisen des 17. Jahrhunderts, sicher in einzelnen Regionen und Ortschaften äußerst unterschiedlich wahrgenommen und erlebt wurde, so wirkte er sich doch mittel- oder unmittelbar auf die Lebenswirklichkeiten der Menschen im Dorfe aus.
Das Kriegsgeschehen erfasste die Region am Untermain erstmals im Jahre 1620, als Truppen der Katholischen Liga das evangelische Eppstein samt
Burg plünderten. Eddersheim blieb – wie andere katholische Orte – von unmittelbaren Kriegseinwirkungen zunächst verschont. Indes sollen einige Ansässige zum Bau von Befestigungsanlagen in Mainz herangezogen worden sein.
Kurze Zeit später wurden die Eddersheimerinnen und Eddersheimer selbst zu Opfern des Krieges: 1622 setzten Verbände der evangelischen Union auf dem Weg aus der Pfalz zur Schlacht bei Höchst die Eddersheimer Kirche
in Brand – nicht, ohne vorab das Gotteshaus ausgeraubt zu haben. In der kommenden Zeit mussten die Dorfbewohnerinnen und -bewohner die Gottesdienste im benachbarten Flörsheim besuchen.
In den Folgejahren zogen immer wieder Truppen der unterschiedlichen Kriegsparteien durch Eddersheim. Manchmal kam es zu Einquartierungen,
zu Beschlagnahmungen von Vieh und Gütern, zu Plünderungen und Brandstiftungen. Auch Söldner wurden im Dorf angeworben.
1631 wurde Flörsheim nach achttägiger Belagerung durch schwedische Verbände eingenommen; in den umliegenden Orten wurden Soldaten der siegreichen Truppen einquartiert. 1632 setzte man Graf Heinrich Volrad
von Stolberg als Herrscher über die Königsteiner Lande und damit auch Eddersheim ein. Im Jahre 1634 eroberten die kaiserlichen Truppen das Gebiet am Untermain jedoch wieder zurück; im Folgejahr fiel das Dorf zurück an Kurmainz.
Als der Dreißigjährige Krieg 1648 schließlich ein Ende fand, war das Heilige Römische Reich in Teilen stark verwüstet – man schätzt heute, dass durch-
schnittlich etwa 30 bis 40 % der Bevölkerung den direkten wie indirekten Kriegsauswirkungen zum Opfer gefallen sind. Und auch in der Folgezeit blieb der Alltag krisenhaft.

DER SCHWARZE TOD
DER SCHWARZE TOD

Nach der großen Pandemiewelle des "Schwarzen Todes" in Europa im
14. Jahrhundert, kam es auch in den folgenden Jahrhunderten immer
wieder zu regionalen wie lokalen Ausbrüchen der Pest in ganz Europa.
Die Ausbreitung von Seuchen wie Hungersnöten wird seit jeher durch Kriege und Katastrophen begünstig. So verhielt es sich auch nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges.
Für Eddersheim wird ein Ausbruch der hochgradig ansteckenden Infektionskrankheit für das Jahr 1624 verzeichnet. Elf Menschen fielen
diesem zum Opfer – unter ihnen auch der damalige Schultheiß Johann Geraun.
Es ist zu vermuten, dass der Bau der Kapelle zum Heiligen Kreuz (heute
auch "Pestkapelle" genannt) im Jahre 1631 als Dankesgabe für die erhoffte Verschonung von einer weiteren Pestwelle wie vor den Schrecken des
Krieges verstanden werden kann.
Zwischen 1637 und 1658 brach die Pest immer wieder in den Ortschaften
am Untermain aus. Stark betroffen war auch das nahegelegene Flörsheim.
1666, 18 Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, wurden
Eddersheims Bewohnerinnen und Bewohner abermals Opfer eines Seuchen-
ausbruchs. Während in Flörsheim etwa ein Drittel der Bevölkerung den Tod fand, starben in Eddersheim noch bis 1669 zahlreiche Menschen an der Pest – genaue Zahlen sind nicht bekannt.
In der Folgezeit führte man in Eddersheim alljährlich am 14. September –
am Fest der Kreuzerhöhung – eine Prozession zur Erinnerung an die Pest-
opfer durch. Auch die Errichtung von Feldkreuzen ab 1666 könnte in diesem Zusammenhang verstanden werden. Noch Mitte des 18. Jahrhunderts ließen die Eddersheimerinnen und Eddersheimer vom Maler Franz Josef Heideloff ein Gemälde des Heiligen Sebastian, dem "Pest-Patron", gestalten und in der Kirche platzieren.

HEXENVERFOLGUNG
wie die Pest, im Zusammenhang der Krisen jener Zeit zu verstehen.
Kriege, die Kleine Eiszeit, Seuchen - all diese Umstände begünstigten vor dem Hintergrund des Glaubens an Magie
und dessen Einbeziehung in das Strafrecht die massenhafte Verfolgung von vermeintlich Zauberei Praktizierenden; vor allem von Frauen.
Eddersheims Ortschronist Pfarrer Bruno beschreibt in seinem 1965 erschienen Buch "Geschichte von Eddersheim" vom Schicksal der Eulalia Best, Ehefrau des Schmiedes Niklas Best. Dieser soll seine Ehefrau 1632 wegen Hexerei gemeldet haben, um sich ihrer zu entledigen. Eulalia Best musste im Zuge der folgenden Anklage Eddersheim verlassen; über ihr weiteres Schicksal ist nichts bekannt. Ihr Ehemann schloss jedoch alsbald eine neue Ehe.
Weitere Fälle der Hexenverfolgung sind aus Eddersheim bisher nicht bekannt; ebenso verhält es sich derzeit noch mit Okriftel. Für Hattersheim lassen sich allerdings die Schicksale von sieben Frauen rekonstruieren, die zwischen 1597 und 1601 unter Verdacht gerieten, schließlich angeklagt und verurteilt wurden.
JAHRE DES WIEDERAUFBAUS
JAHRE DES WIEDERAUFBAUS

Im Zuge all dieser krisenhaften Entwicklungen hatte Eddersheim unter
einem empfindlichen Rückgang der Bevölkerung zu leiden. Auf Initiative
der Mainzer Dompröpste wurden in der Folgezeit aktiv neue Bewohnerinnen
und Bewohner im Dorf angesiedelt. Diese stammten offenbar hauptsächlich
aus dem Eichsfeld, einer Exklave des Erzbistums.
Vor allem unter dem Erzbischof Johann Philipp von Schönborn (1647-1673) wurden zahlreiche Projekte im Sinne des Wiederaufbaus in Angriff genommen; zudem engagierte dieser sich offensichtlich im Kampf gegen den Hexenwahn sowie bei der Neuordnung des Schulwesens.
Auch die Verwaltung der Gemeinde wurde in der Folgezeit neu strukturiert. Seit dem Kriegsende gab es in Eddersheim einen vom Dompropst eingesetz-
ten Oberschultheißen sowie einen Unterschultheißen. Letzterer war einer
von sechs Schöffen am Ort.
Aus den ab den 1650er Jahren überlieferten Gemeinderechnungen der Schultheißen ist die Aufwärtsentwicklung Eddersheims abzulesen. Sie belegen, dass es im Dorf zu diesem Zeitpunkt neben einem Kirchbrunnen unter anderem auch ein Backhaus, eine Gemeindewaage und eine Schmiede gab. Zudem sind die Positionen des Gemeindehirten, des Gemeindeschützen sowie eines Weingarten-Schützen nachweisbar.
Auch die Gebäudeinfrastruktur wurde in den Nachkriegsjahren rasch erneuert. 1650 wurde die Kapelle am Mönchhof wieder aufgebaut - die Eddersheimer Kirche wurde alsbald neu errichtet. 1660 konnte ein neues Schulgebäude eingeweiht werden. Zu dieser Zeit soll es im Dorfe sogar
eine Kegelbahn gegeben haben.
Der Ausbruch einer Feuersbrunst im April 1681, welcher insgesamt
22 Häuser nebst Ställen und Scheunen zum Opfer fielen, waren ein
verheerendes Ereignis für die Eddersheimerinnen und Eddersheimer.
Es konnte jedoch den bemerkenswerten Aufschwung des Ortes nicht nachhaltig beeinflussen.

HUGO GRAF VON ELTZ
HUGO GRAF VON ELTZ


ZEITEN DES WOHLSTANDS IM 18. JAHRHUNDERT
Eine Blütezeit erlebte Eddersheim schließlich unter der Herrschaft des Mainzer Dompropstes Hugo Graf von Eltz in der Zeit von 1743 bis 1778.
Der Dompropst galt allgemein als Förderer der Kunst und Kultur. Er soll eine umfangreiche Buch- wie Waffensammlung besessen haben sowie als Stifter aufgetreten sein. Eddersheim war er offenbar sehr zugetan.
Das Fischerdorf verdankte ihm etliche Schenkungen, unter anderem drei Glocken für die Pfarrkirche, ein Porträt des Dompropstes, ein silbernes Ewiges Licht, Kerzenleuchter sowie Messkelche, welche sich zum Teil bis heute im Besitz der Kirche befinden. Auch eine Kreuzigungsgruppe, welche heute in der Pfarrkirche steht, zählt zu seinen Stiftungen. Im Jahre 1765 ließ Graf von Eltz darüber hinaus für 100 Gulden alle Eddersheimer Straßen Pflastern.
Auf die Veranlassung des Dompropstes wurde nicht zuletzt für die Kirche in Eddersheim der sogenannte Portiunkula-Ablass erlangt, welcher zuvor in der Kapelle am Mönchhof erworben werden konnte. Durch eine Stiftung stellte er sicher, dass das Portiunkulafest ab 1762 regelmäßig in Eddersheim begangen werden konnte.
Während seiner 35-jährigen Amtszeit verlegte Hugo Graf von Eltz seine Residenz häufig von Mainz in den Propsteihof nach Eddersheim. Noch
heute zeugen die Überbleibsel des einst großzügigen Gartens vom
damaligen herrschaftlichen Gepräge. Die auf der zum Main hin auf
einer Bruchsteinmauer platzierte Nepomuk-Statue ist eine Replik
der ursprünglichen Stiftung des Dompropstes.

GLAUBEN UND KIRCHE
CHRISTIANISIERUNG UND KIRCHENBAU
CHRISTIANISIERUNG UND KIRCHENBAU


Wann der Ort christianisiert wurde, ist nicht bekannt. Erste Kontakte mit der damals neuen Religion dürften die hier ansässigen Menschen bereits um das 2. Jahrhundert nach Christus erlebt haben; seit dem 4. Jahrhundert war Mainz Bischofssitz. Insbesondere durch das Wirken von Missionaren verbrei-
tete sich das Christentum innerhalb weniger Jahrhunderte rasch in den Siedlungen am Untermain. Ein früher Nachweis christlich-institutionalisierter Einflussnahme ist die des Mainzer Benediktinerklosters St. Alban in Okriftel, wobei sowohl die christliche Gemeinde in Eddersheim als auch die in Hattersheim Filialen der Okrifteler Kirche waren.
Ab wann es in Eddersheim genau ein erstes Gotteshaus gab, ist nicht bekannt. Quellen sprechen davon, dass 1335 eine Kirche an der Stelle des heutigen Gotteshauses erbaut worden sei. Ein nächster Nachweis für die Existenz einer Kirche stammt aus dem Jahr 1365. Bekannt ist, dass diese Kirche, wie bereits erwähnt, 1622 in den Kämpfen des Dreißigjährigen Krieges zerstört und erst
30 Jahre später, im Jahr 1652, ein neuer Kirchenbau eingeweiht wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Eddersheim bereits eine selbstständige Pfarrei mit
einer eigenen Filiale - dem auf der anderen Mainseite gelegenen Hofgut Mönchhof.
Bereits 1728/ 1729 wurde am heutigen Standort eine neue Kirche mit einem kleinen Saalbau und barockem Dachreiter errichtet. Es wird vermutet, dass die Bausubstanz des unmittelbar nach Kriegsende errichteten Gebäudes mangelhaft gewesen sein könnte, was einen raschen Neubau erforderlich machte.
Einrichtung, Ausstattung und Gestaltung des Pfarrgartens wie der dazuge-
hörigen Gebäude wurden in den folgenden Jahrhunderten mehrfach
ergänzt und verändert. Eine erste Orgel gab es vermutlich bereits Ende
des 18. Jahrhunderts; erneuert wurde das Instrument zunächst im
19. Jahrhundert und dann abermals um 1900. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde stetig an, sodass die Pfarrkirche alsbald zu klein wurde.

ERWEITERUNG DER KATHOLISCHEN KIRCHE
wurde ein Kirchenbauverein gegründet, welchem es gelang, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 93.000 Mark für
einen Neubau zu sammeln. Die Kriegsereignisse mitsamt
der sich anschließenden Inflation machten die Pläne jedoch
zunächst zunichte. Und auch in den Folgejahren gelang
es den Eddersheimer Pfarrern nur schwer, das Projekt wiederaufleben zu lassen.
Erst in den 1930er Jahren wurde auf Initiative des damaligen Pfarrers Meilinger der Kirchenbauverein wiederbelebt. Die Mittel aus dem Verein, ein durch den Landrat vermittelter Kredit über 20.000 Reichsmark sowie ein Zuschuss von
4.000 Reichsmark aus dem Kultusministerium ermöglichten
es schließlich, dass das Kirchengebäude aus dem Jahr 1728/ 1729 zumindest ausgebaut werden konnte.
In den Jahren 1934/ 1935 entstanden im Süden ein Chor mit Sakristei und im Norden ein neues Hauptschiff. Das vormalige Kirchengebäude dient heute als Querschiff – die Haupt-
richtung der Kirche wurde um 90 Grad gedreht. Auch das
alte Kirchenportal wurde im Zuge der Maßnahmen erneuert.
Zur Innenausstattung der Kirche gehören heute unter anderem ein Hochaltar und zwei Seitenaltäre aus der Zeit
um 1680, ein Taufstein (um 1700) sowie die bereits erwähnten zahlreichen Stiftungen des Grafen Hugo von Eltz.
Nicht mehr vorhanden ist das Geläut aus dem 18. Jahr-
hundert. Im Zuge des Ersten Weltkriegs wurden zwei der Glocken (eine davon ebenfalls eine Stiftung des Dompropstes) eingeschmolzen. Erst 1922 konnte eine neue Glocke eingebaut werden, zwei weitere wurden 1949 geweiht.
Die alte Turmuhr wurde 1963 ersetzt; eine neue Orgel erhielt die Katholische Kirche im Jahre 1983.
DIE EVANGELISCHE KIRCHE
DIE EVANGELISCHE KIRCHE

EINE RELIGIÖSE MINDERHEIT

Selbst zu Zeiten der Reformation war das Dorf vermutlich weiterhin katholisch geprägt. Ein besonderes Konfliktpotential ergab sich aus dem Filialverhältnis zu Okriftel und dessen Herrn, dem reformierten Grafen von Isenburg. Zugleich übten der lutherische Graf von Stolberg-Königstein sowie der Dompropst als katholischer Landesherr Einfluss im Dorf aus, was immer wieder zu Konflikten führte. 1595 wurde Eddersheim schließlich von der Okrifteler Kirche gelöst und zu einer Filiale der Gemeinde Flörsheim.
Der Anteil an evangelischen Gläubigen am Ort wuchs erst Ende des
19. Jahrhunderts langsam an. Im Kriegsjahr 1917 lebten in Eddersheim
1.240 Katholikinnen und Katholiken sowie immerhin 92 Protestantinnen
und Protestanten.
BAU DER EVANGELISCHEN KIRCHE
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wuchs mit dem Anstieg der Bevölkerungszahlen insgesamt auch der Zustrom der Protestantinnen und Protestanten. 1955 hatte sich das Verhältnis zwischen den katholischen und evangelischen Gläubigen auf 1.789 zu 440 gewandelt. Bis zu diesem Zeitpunkt gehörten die evangelischen Christen wiederum der Kirchengemeinde in Okriftel an.
Der Zuwachs der Gemeinde beförderte den Wunsch nach einem eigenen Gotteshaus. 1962 wurde in der Anton-Flettner-Straße mit dem Bau einer Evangelischen Kirche begonnen, welche am 1. Dezember 1963 mit einem Festgottesdienst eingeweiht werden konnte. Um diese Zeit lebten in Eddersheim etwa 2.280 Katholikinnen und Katholiken sowie circa 800 Protestantinnen und Protestanten. Seit dem Mai 1965 besitzt die Kirche
auch ein eigenes Geläut.

EDDERSHEIMER SCHULGESCHICHTE
DIE ANFÄNGE DER EDDERSHEIMER SCHULE
geschichte eines Ortes, welche vergleichsweise gut
überliefert und epochenübergreifend Spiegel der Politik-
wie Gesellschaftsgeschichte ist – so auch in Eddersheim.
Den Beginn eines eigenen Schulwesens in Eddersheim kann man auf das Ende des 16. Jahrhunderts datieren. Nachdem die Kinder des Dorfes zunächst in Okriftel unterrichtet worden waren, soll um 1600/ 1601 eine erste Schule in Eddersheim errichtet worden sein. Dieses Ereignis deckt sich in etwa mir der Loslösung Eddersheims von der Okrifteler Kirche
im Jahre 1595.
Schon 1660 wurde offensichtlich ein neues Schulhaus gebaut – vermutlich nach Abriss des Vorgängergebäudes an gleicher Stelle in der Backesstraße, welche früher auch Schulstraße hieß. Es soll neben einem Unterrichtsraum auch eine Lehrerwohnung umfasst haben.
Die an der Eddersheimer Schule tätige Lehrkraft hatte damals zahlreiche Aufgaben: Neben dem Einsatz in der Lehre war man beispielsweise auch als Chronist, als Organist, als Glöckner wie Chorleiter tätig. Zudem belegen Quellen, dass die Lehrkraft die Wäsche und Gerätschaften der Kirche sauber zu halten und die Gemeindewaage zu bedienen hatte. Aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist ferner überliefert, dass der Lehrer vor der Oberpforte einen Garten pflegte.
Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als das Gebiet an Hessen-Darmstadt fiel, musste der Eddersheimer Lehrer darüber hinaus am südlichen Mainufer lebende Schülerinnen und Schüler unterrichten.
DAS SCHULWESEN IM WANDEL
DAS SCHULWESEN IM WANDEL


wie andernorts auch - das Schulwesen insgesamt ausgebaut und die Simultanschule, der gemeinsame Unterricht ohne Ansehen des Glaubensbekenntnisses, eingeführt.
In Eddersheim ersetzte ab 1824 offenbar an gleicher Stelle ein neues Schulgebäude den zu klein gewordenen und maroden Altbau aus dem
17. Jahrhundert. Es handelt sich dabei um das spätere Pfarrhaus. Das
neue Schulhaus, abermals direkt neben der Kirche verortet, bot in zwei übereinanderliegenden Sälen Platz für den Unterricht von circa 140
bis 150 Schulkindern.
Ab 1826 war hier, neben dem verantwortlichen Lehrer, zusätzlich ein Lehrergehilfe tätig - ab 1858 eine zweite ausgebildete Lehrkraft. Das Aufgabenportfolio der Lehrkräfte wurde sukzessive von den kirchlichen Tätigkeiten wie Küster- oder Glöcknerdiensten gelöst. Durch den im Zuge
der fortschreitenden Industrialisierung des Rhein-Main-Gebietes ausgelösten Anstieg der Bevölkerungszahlen wuchs auch die Zahl der zu unterrichtenden Schülerinnen und Schüler. Ab 1902 war erstmals eine weibliche Lehrerin
an der Schule tätig, 1907 mussten bereits die Räume des Eddersheimer Rathauses zu Unterrichtszwecken mitbenutzt werden. Abermals wurde
ein Schulneubau nötig.
Am 26. April 1911 konnte die neue Schule am Hopfengarten feierlich eingeweiht werden – nicht ohne Einsegnung durch den Pfarrer, welcher
auch den singenden Festzug von der alten zur neuen Schule begleitete.
Der moderne Backsteinbau bot nunmehr Platz für vier Klassenräume.

IN DEN NEUBAU VON 1911 INTEGRIERTESVOLKS- UND SCHÜLERBAD
DIE SCHULE AM WEIßEN STEIN
DIE SCHULE AM WEIßEN STEIN


station und eine "Kleinkinderbewahrschule" eingerichtet. In dieser Art Kindergarten konnten nochmals 80 bis 100 Kinder betreut werden. Im Obergeschoss des Gebäudes wurde zudem Handarbeitsunterricht für Mädchen durchgeführt. Darüber hinaus übernahmen vier Schwestern der Limburger Pallottinerinnen dort Aufgaben der Alten- und Krankenpflege.
Bis in das Jahr 1964 blieb die ehemalige Schule ein Schwesternhaus.
Und auch das Schulgebäude am Hopfengarten wurde bis in die Nachkriegs-
zeit unverändert weitergenutzt, wenngleich sich der bauliche Zustand
des Schulhauses wohl stetig verschlechterte. Erst 1954 wurde es um zwei zusätzliche Klassenräume, um Sanitäranlagen und eine Lehrerwohnung erweitert.
Im Zuge des Bevölkerungswachstums nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sowie den Entwicklungen rund um den Freiwilligen Zusam-
menschluss von Eddersheim, Okriftel und der Stadt Hattersheim
ab Mitte der 1960er Jahre wurden Pläne für einen Neubau der Schule konkreter. Aufgrund der Raumnot musste der Unterricht zwischenzeitlich
etwa im Schichtbetrieb oder aber in Räumen im benachbarten Weilbach durchgeführt werden. Nach der Reform des Schulbetriebs wurden ab
1971 Schülerinnen und Schüler ab der vierten Klasse an der Hattersheimer Gesamtschule unterrichtet. 1973 konnte schließlich der Neubau der Edders-
heimer Schule (jetzt: Grundschule) auf dem Gelände Am Weißen Stein eröffnet werden.
Der Neu- und Ausbau der heute stehenden Schule wurde ab dem Jahre 2009 realisiert; seit 2020 werden abermals Erweiterungsmaßnahmen umgesetzt.
Das alte Schulgebäude am Hopfengarten wurde 2014 unter Denkmal-
schutz gestellt. Die Behörde begründete dies mit der ortsgeschichtlichen
wie städtebaulichen Bedeutung des Gebäudes, welches darüber hinaus von hohem baukünstlerischen Wert ist; es zeigt exemplarisch den Übergang vom Jugendstil zur Neuen Sachlichkeit.

EDDERSHEIM IM WANDEL - DAS 19. JAHRHUNDERT
AUF DEM WEG IN DIE MODERNE
AUF DEM WEG IN DIE MODERNE

Das Ende alter politischer Ordnungen, die Auswirkungen der Industriellen Revolution, die Ausbildung von Nationalstaaten, die Deutsche Revolution,
die Soziale Frage und die Entwicklung der Arbeiterbewegung – all diese Geschehnisse und Entwicklungen führten dazu, dass die Gesellschaft des
19. Jahrhunderts sich grundlegend von der vorheriger Jahrhunderte unterschied. So auch in Eddersheim.
Die veränderten Machtverhältnisse mit dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zu Beginn des 19. Jahrhunderts
hatten natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf das Leben im Dorf - insbesondere durch das Ende des Mainzer Kurfürsten- und Erzbistums sowie die damit einhergehende Säkularisation.
Ab 1803 gehörte das Dorf zu Nassau-Usingen, seit 1806 zum Herzogtum Nassau und damit zum Rheinbund. Das Mainzer Erzbistum übte nun keine weltliche Herrschaft mehr aus und verlor auch seinen Grundbesitz am Ort.
Im Dompropsteihof richtete man ein Rathaus ein. Darüber hinaus wurde der Main nunmehr zu einer Grenze, waren doch die Gebiete am jenseitigen Ufer
an das Großherzogtum Hessen-Darmstadt gefallen.
Und natürlich wandelten sich vor dem Hintergrund der Geschehnisse auf Reichsebene auch die Zugehörigkeiten zu Verwaltungs- und Gerichts-
bezirken in der Region spätestens mit der Gründung des Deutschen
Bundes nachhaltig.
Während Eddersheim ab 1803 zum Amt Hochheim gehörte, wurde es seit 1814 dem Amt Wallau zugeordnet. Nur drei Jahre später war das Amt Hochheim wieder zuständig. 1849 zählte man Eddersheim zum Verwaltungsbezirk IX mit dem Kreisamt in Höchst, 1854 wiederum zum Amtsbezirk Hochheim.
Im Zuge der Deutschen Krieges fiel das Herzogtum Nassau und so auch Eddersheim 1866 an Preußen. In der Folgezeit war das Dorf Teil des Landkreises Wiesbaden in der Provinz Hessen-Nassau.

FORTSCHREITENDE INDUSTRIALISIERUNG
an anderen Orten hervorrief, gab es in Eddersheim zunächst nicht. Insgesamt entwickelte sich das Dorf eher allmählich zu einem modernen Arbeiterwohnort.
Während im Jahre 1800 etwa 470 Einwohnerinnen und Einwohner in Eddersheim lebten, waren es 1834 gerade
einmal 671. Nach einem erneuten moderaten Zuwachs auf
762 im Jahr 1852, gingen die Einwohnerzahlen bis in die 1870er Jahre sogar wieder zurück.
In jenen Jahren veränderte sich jedoch die Zusammen-
setzung der Dorfbevölkerung und das bis dahin noch
vom Fischfang und der Landwirtschaft dominierte Leben
am Ort begann sich zu wandeln. Es lebten nun zunehmend Menschen in Eddersheim, welche in den umliegenden Fabriken wie den Farbwerken Hoechst oder den Opel-
werken in Rüsselsheim tätig waren.
Auch die Gestalt des Ortes änderte sich in jener Zeit
zunächst nur wenig. 1807 wurde der Dorfgraben auf-
gegeben und verfüllt und das Gelände wurde zu
Ackerland; auch die Oberpforte wurde abgebrochen.
1817 wurde außerhalb der alten Dorfbefestigung ein
neuer Friedhof angelegt.
Selbst der Bau der Taunus-Eisenbahn zwischen Frankfurt
und Wiesbaden, welche 1839/ 1840 eröffnet wurde, beförderte die Entwicklung des Ortes zunächst nur wenig. Während in den umliegenden Ortschaften Industriebetriebe entstanden und die Eisenbahn zu einem Motor der Aufwärtsentwicklung wurde, änderte sich in Eddersheim zunächst nicht viel.
Ein regulärer Bahnhof wurde erst 1891 errichtet.
Fahrt nahm die Ortsentwicklung erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts auf. Ab der Mitte der 1880er Jahre stiegen die Bevölkerungszahlen deutlich an – 1905 zählte Edders-
heim 1.116 Einwohnerinnen und Einwohner. In der Zeit von 1866 bis 1918 nahm auch die Siedlungsfläche um 4,9 auf 11,4 Hektar zu. Es entstanden neue Wohnquartiere und das nicht nur rund um den alten Ortskern, sondern auch in Richtung der Bahnlinie.
EDDERSHEIM NACH DER JAHRHUNDERTWENDE
EDDERSHEIM NACH DER JAHRHUNDERTWENDE


Ausbau der örtlichen Infrastruktur in Gang.
Im Jahre 1901 wurde im Rathaus eine Poststelle eingerichtet, welche alsbald in das Gebäude Bahnhofsstraße 16 verlegt werden musste. Der 1817 angelegte Friedhof reichte nicht mehr aus, sodass im Jahre 1909 ein neuer Friedhof am heutigen Standort errichtet wurde. 1911 konnte, wie bereits erwähnt, ein neues Schulgebäude eingeweiht werden; im gleichen Jahr verfügte Eddersheim über eine erste Stromleitung.
Ein Blick in die Gebäudekataster aus den Jahren 1907/08 zeigt, dass in
jener Zeit keine hauptberuflich tätigen Fischer mehr im Dorf lebten,
jedoch zwölf Schreiner und acht Schlosser. Die Kanalisierung des Mains
wie die am Fluss entstandenen Fabriken hatten die Qualität des Wassers nachhaltig verschlechtert, was den Fischfang deutlich erschwerte. Darüber hinaus boten die Industriebetriebe neue Verdienstmöglichkeiten an.
Große Arbeitgeber am Ort waren in jenen Jahren eine Möbelschreinerei
mit 24 Beschäftigten und eine Schneiderei mit Tuchgeschäft mit 12 Mitarbeitenden.

ERSTER WELTKRIEG UND BESATZUNGSZEIT
ERSTER WELTKRIEG UND BESATZUNGSZEIT
ERSTER WELTKRIEG UND BESATZUNGSZEIT
"Was man befürchtete, ist Wirklichkeit geworden. […] Weltkrieg! Möge Gott uns beistehen und beschützen und uns einen glücklichen Ausgang des Krieges verleihen!"

Bereits am gleichen Tag zogen die ersten Eddersheimer in den Krieg; die Nachricht über die ersten gefallenen Soldaten erreichte die Dorfgemeinschaft am 13. Oktober des Jahres: Peter Lindner war bei St. Remy, Ludwig Dienst bei Chalons sur Marne und Philipp Blisch bei Cornay gefallen. Bis zum Ende des Krieges im Jahre 1918 stieg die Zahl der im Kampf Gefallenen auf 34.
Neben dem Fehlen der zum Kriegsdienst eingezogenen Männer bei der
Arbeit im Dorfe und in den Familien, wirkte sich der Krieg im Alltag der Menschen vor allem durch die Einquartierung von Soldaten ab 1915
aus; im Schwesternhaus wurde ein Hilfslazarett eingerichtet. Auch der Unterricht der Kinder des Dorfes litt unter den Kriegsgeschehnissen. 1915
war Lehrer Albert Will einberufen worden; die Stelle blieb unbesetzt. Nur
noch zwei Lehrerinnen und ein Lehrer mussten sich in der Folgezeit um
mehr als 250 Kinder kümmern.
Wie andernorts auch, so wurde auch die Eddersheimer Bevölkerung im
Verlauf des Krieges immer häufiger zur Unterstützung der Truppen im Felde aufgerufen. So fanden Sammlungen von Spendengeldern, aber beispielsweise auch von Gummi, Blei, Aluminium, Messing oder aber von Lebensmitteln und Kleidung statt. Lehrkräfte und Pfarrer riefen die Eddersheimerinnen und Eddersheimer aktiv zur Zeichnung von Kriegsanleihen auf. Letzterem wurde ob seines patriotischem Engagements noch im Juli 1918 das "Verdienstkreuz für Kriegshilfe" verliehen.
Doch hatte sich bereits zuvor die Kriegssituation und die allgemeine Versor-
gungslage für die Zivilbevölkerung massiv verschlechtert. Schon im Mai 1917 waren 25 unterernährte Kinder aus Biebrich zur Erholung nach Edders-
heim verbracht worden. Wie bereits erwähnt, mussten in dieser Zeit auch zwei der Kirchenglocken abgeben werden. Darüber hinaus hatte Pfarrer Krah dazu aufgerufen, Lebensmittel für die notleidende Stadtbevölkerung abzugeben. Lebensmittel und andere Güter wurden rationiert und gegen Marken herausgegeben.
Die Situation verschlimmerte sich zusehends, Hunger und Gesetzlosigkeit bestimmten den Alltag. Als der Erste Weltkrieg im Herbst 1918 schließlich endete, bedeute dies nicht das Ende des Kriegsleidens.
Auch wenn die Kampfhandlungen eingestellt wurden, herrschten weiter Mangel und Not. In Eddersheim erlebte die Bevölkerung noch eine zusätz-
liche Belastung. Neben den Gebieten links des Rheins, wurde der rechts-
rheinische Brückenkopf bei Mainz und somit auch Eddersheim durch französische Truppen besetzt. Im Dezember 1918 wurden 600 und nach deren Abzug nochmals 400 Franzosen im Ort einquartiert. Untergebracht wurden die Soldaten unter anderem in der Schule, sodass hier wiederum
kein Unterricht stattfinden konnte. In dieser Zeit gab es nächtliche Ausgangs-
sperren und weitere Einschränkungen; bewaffnete Soldaten gehörten zum Alltagsbild. Bis in Eddersheim wieder ein annähernd normaler Alltag einkehrte, sollte noch einige Zeit vergehen.
Ende 1918 fand nicht nur ein Weltkrieg sein Ende – auch das Deutsche Kaiserreich gab es nun nicht mehr. Völlig veränderte internationale Konstel-
lationen, neue Gesellschaftsordnungen, politische Wirren, materielle wie soziale Not, Inflation, traumatisierte und dauerhaft körperlich geschädigte Kriegsheimkehrer – all dies und mehr wurde in der Folgezeit zu einer schweren Belastung der neu entstandenen Weimarer Republik.

DIE EDDERSHEIMER STAUSTUFE
FLUSSSPERREN VERBESSERN SCHIFFBARKEIT
FLUSSSPERREN VERBESSERN SCHIFFBARKEIT


Nachdem in den 1840er Jahren bereits Maßnahmen für eine Mittelwasser-korrektion begonnen hatten, sollte der Fluss in der Folgezeit zu einer modernen Wasserstraße ausgebaut werden. In den Jahren 1883 bis 1886 wurden zwischen Frankfurt und der Mainmündung in den Rhein zunächst
fünf Sperren erbaut – in Niederrad, Höchst, Okriftel, Flörsheim und in Kostheim. Sie verfügten jeweils über ein Nadelwehr, eine Floßgasse, eine Schleusenanlage und einen Fischpass. Bereits kurze Zeit später mussten diese Bauwerke erweitert werden, um den steigenden Bedarf der Schifffahrt decken zu können.
Zu einem erneuten Ausbau der Wasserstraße kam es Ende der 1920er
Jahre. Die fünf Staustufen aus dem 19. Jahrhundert wurden durch
drei neue Bauwerke in Griesheim, Eddersheim und Kostheim ersetzt.
Weniger und modernere Bauten sollten dabei das Schleusen größerer
Schiffe in kürzerer Zeit ermöglichen.

BAU DER STAUSTUFE
in der Zeit von 1929 bis 1934 realisiert.
Die Bauarbeiten hatten einen großen Einfluss auf den
Alltag der Eddersheimerinnen und Eddersheimer. Auf der entstandenen Großbaustelle gab es tagein, tagaus ein reges Treiben. Neben einer Feldbahn gab es jenseits des Mains
auch eine Kantine.
Allein die stetige Lärmbelästigung, etwa durch die Einbringung von Spundwänden, muss die Lebensqualität
im Dorf deutlich eingeschränkt haben. Das Projekt führte andererseits jedoch auch zu einem wirtschaftlichen Auf-
schwung am Ort und in der Region. Auf der Baustelle waren durchschnittlich etwa 240 Personen beschäftigt; zeitweise sollen sogar bis zu 500 Arbeiter dort tätig gewesen sein.
Drei Arbeiter starben infolge von Unfällen.
Insgesamt wurden beim Bau der Staustufe etwa 78.000 Kubikmeter Beton und 10.000 Tonnen Stahl verbaut – man schätzt, dass circa 1,5 Millionen Kubikmeter Erde im Zuge
der Bauarbeiten bewegt werden mussten.
Am 1. Oktober 1934 passierte mit dem Dampfer "Preußen" ein erstes Schiff die neu errichtete Schleuse der Staustufe. Seither besitzen die Eddersheimerinnen und Eddersheimer durch den Fußgängersteg zudem eine sichere Querungs-
möglichkeit über den Main, wo man zuvor auf ein Boot
oder Floß zum Übersetzen angewiesen war.
KRAFTWERKBAU
Realisiert werden konnte dieses Projekt allerdings
erst 1940/ 1941.
Vor allem der (kriegsbedingte) Mangel an Stahl und anderen Rohstoffen ließ die Fertigstellung der Arbeiten stocken. Zudem fehlte es der Stadt Frankfurt, welche den Bau finanzieren und im Gegenzug den produzierten Strom erhalten sollte, zeitweise an Geld zu dessen Umsetzung.
Das schließlich im Betonskelettbau errichtete Kraftwerk versorgte so auch zunächst die Frankfurter Elektrizitätswerke und das Wasserwerk mit Strom, wobei letzteres ebenfalls von der Stadt Frankfurt betrieben wurde.
SCHLEUSENSIEDLUNG
SCHLEUSENSIEDLUNG

Bereits im Jahre 1927 begann der Bau der bis heute erhaltenen Eddersheimer Schleusensiedlung. An der Mainuferstraße (ab 1938: Hindenburgstraße; heute: Mönchhofstraße) errichtete man vier Doppelhäuser für Schleusenarbeiter sowie zwei für Beamte und Angestellte. Ende 1928 waren die ersten zwölf Wohnungen bezugsfertig.
Im Gegensatz zur klaren und an den Bauhausstil erinnernden Bauweise der Staustufe, wurden die Wohnhäuser im sogenannten Heimatstil errichtet. Sprossenfenster und steile, mit Schiefer gedeckte und durch Gauben ergänzte Satteldächer prägen die Gestalt der Bauten. Zudem legte man Gärten mit Ställen an, um eine Selbstversorgung mit Lebensmitteln zu ermöglichen.
In den Häusern der Beamten gab es im Obergeschoss ein Bad, in den Arbeiterhäusern hingegen nur eine Bademöglichkeit in der Waschküche.
1942 erweiterte man die Wohnkolonie für die Schleusenbediensteten entlang der Kraftwerkstraße. Diese Gebäude waren wesentlich bescheidener ausgestattet als die zuvor errichteten. Sie besaßen aus Luftschutzgründen besonders dicke Mauern sowie einen Luftschutzbunker. Nach Kriegsausbruch hatte man auch die anderen Häuser mit Luftschutzkellern ausgestattet.

DIE STAUSTUFE HEUTE
des Ortes.
Sie verfügt über ein Walzenwehr mit drei Durchlässen, welches den Zufluss zum Kraftwerk regelt.
Die Doppelschleuse ermöglicht es, dass zeitgleich flussauf-
und flussabwärts geschleust werden kann. Sie ist 350 Meter lang – gemeinsam fassen die Kammern 20.000 Kubikmeter Wasser. Zudem gibt es eine Sportbootschleuse, welche von den Schifffahrenden selbst bedient werden kann. Darüber hinaus gibt es heute noch einen Fischpass. Rund 17.000 Schiffe werden hier jährlich geschleust (Stand: 2020).
Das Eddersheimer Kraftwerk erzeugt heute im Jahr
rund 25.000 Megawattstunden Strom, welcher als Ökostrom verkauft wird. Die Leistung des Werks hängt dabei zum einen von der Auslastung der Schleuse durch den Schiffsverkehr
und zum anderen vom Wasserstand des Mains ab.
Im Jahr 2010 wurde die Schleuse zuletzt modernisiert. Neben einem Austausch des Antriebs der Schleusentore, war vor allem der Einbau einer möglichen Fernsteuerung von entscheidender Bedeutung. Bis zu diesem Zeitpunkt waren
vor Ort noch zehn Mitarbeitende tätig gewesen – seit dem
Jahr 2013 ist kein Personal mehr dauerhaft in Eddersheim eingesetzt. Die Schleusenanlage wird seither von der Kostheimer Staustufe aus gesteuert – das Kraftwerk
wiederum von der Staustufe Griesheim.
Die Staustufe mit Schleuse und Kraftwerk stehen, wie die Schleusensiedlung, seit 1985 unter Denkmalschutz.
ANTON FLETTNER
ANTON FLETTNER LEHRER-ERFINDER-INGENIEUR
ANTON FLETTNER LEHRER-ERFINDER-INGENIEUR

DIE ERSTEN JAHRE

Anton Flettner, Mein Weg zum Rotor, 1926
Der sicherlich bekannteste Sohn Eddersheims ist Anton Flettner. Bis heute
ist sein Name untrennbar mit der Lokalgeschichte des Ortes verbunden –
bis heute leben Nachfahren der weit verzweigten Familie in Eddersheim.
Anton Flettner wurde am 1. November 1885 in Eddersheim als Sohn einer alten Rhein- und Main-Schifffahrer-Familie geboren. Sein Vater, Peter
Flettner (1864 bis 1918), hatte das Unternehmen "Flettner's Personen-
schiffahrt" gegründet, welches ab den 1920er Jahren als Reederei-
gemeinschaft "Flettner-Nauheimer" weitergeführt und zum Vorgänger-unternehmen der heutigen "Primus-Linie" werden sollte. In der Reederei seines Vaters konnte sich Anton Flettner erste Grundkenntnisse im Bereich
des Schifffahrtswesens aneignen.
Peter Flettners Unternehmen scheint sehr erfolgreich gewesen zu sein: Im Jahre 1908 ließ er außerhalb des alten Ortskerns (heute: Bleichstraße) ein Wohnhaus in Form einer Gründerzeitvilla errichten, welches bis heute als "Flettner-Villa" oder "Flettner-Schlösschen" bekannt ist. Es blieb nur rund dreißig Jahre im Besitz der Familie. Ab 1939 nutzte die Gemeinde das Gebäude als Rathaus. Im Zuge des Freiwilligen Zusammenschlusses 1972 ging es
in den Besitz der Stadt Hattersheim über, die es zunächst als Verwaltungs-
außenstelle nutzte. 1988 wurde hier der Kindergarten "Villa Kunterbunt" unterbrachte; im Jahre 2010 wurde das Gebäude umfassend saniert.
Anton Flettner selbst hat vermutlich nur kurze Zeit seines Lebens in der "Flettner-Villa" verbracht. Nach dem Abschluss seiner Schullaufbahn mit dem Besuch der Elementarschule Eddersheim sowie bis 1901 des Gymnasiums in Höchst, unternahm er 1902 eine erste See-Fernreise. Nach seiner Rückkehr besuchte Flettner ab 1903 das Lehrerseminar in Fulda. Mit dem Abschluss seiner Ausbildung nahm er 1905 eine Lehrerstelle in Pfaffenwiesbach, später dann in Lorsbach an. 1912 wechselte er schließlich an die Gewerbeschule in Frankfurt, wo er Mathematik und Physik unterrichtete.
Bereits im Jahr 1910 hatte er die 1893 in Frankfurt am Main geborene Lydia Freudenberg geheiratet. Im Jahr 1913 kam ihre gemeinsame Tochter Ingeburg zur Welt.

DER ERFINDERDER WEG ZUM "FLETTNER-RUDER"
Bereits seit früher Jugend zeigte er großes Interesse an
den Themenkomplexen der Mechanik, der Strömungslehre - experimentierte er mit dem Bau von Antrieben und anderen Dingen. Es entstanden erste kleinere Prototypen.
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs fanden seine Ideen Beachtung beim Militär. Im Jahr 1914, Flettner war 29 Jahre alt, präsentierte er dem Reichsmarineamt den Entwurf für den Bau eines lenkbaren Torpedos. Kurze Zeit später entwickelte er eine drahtlose Fernsteuerung für einen Tankkampf-
wagen. Vom Reichsmarineamt wurden beide Vorschläge als nicht realisierbar abgelehnt. Doch wurde sein Engagement zum Ausgangspunkt für seine weitere Karriere.
In der Zeit von 1916 bis 1917 war Anton Flettner als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter bei der Inspektion der Fliegertruppen eingesetzt. In dieser Zeit konstruierte er das so genannte "Flettner-Ruder" (auch: "Flettner-Klappe"). Hierbei handelte es sich um ein Steuerelement für ein Ruder, durch welches dessen Wirkung unterstützt und die aufzuwendende Kraft verringert wird. Es fand zunächst im Flugzeug-, nach Kriegsende dann im Schiffsbau Anwendung. Der Erfolg seiner Erfindung ließ Flettner den Lehrerberuf aufgeben.
In der Folgezeit gründete er Firmen in Rotterdam sowie
in Berlin; 1922 wurde schließlich die "Flettner-Ruder-Vertriebsgesellschaft" in Köln-Weseling gegründet.
DER "FLETTNER-ROTOR"
DER "FLETTNER-ROTOR"


Zur gleichen Zeit übernahm Flettner den Posten des Direktors einer technischen Forschungseinrichtung in Amsterdam. Hier begann er mit der Entwicklung eines neuen Schiffsantriebs.
Basierend auf bekannten Forschungen zu rotierenden Zylindern, konstruierte Flettner den nach ihm benannten Rotor, welcher wie ein Segel wirkt und durch den sogenannten Magnus-Effekt Kraft erzeugt.
Nachdem er zuvor bereits einige Modelle gefertigt hatte, konnte sein berühmtes Rotorschiff "Buckau" im August 1924 in Kiel vom Stapel laufen. Jedes ihrer zwei rund 18 Meter hohen Walzensegel wurde von einem Elektromotor angetrieben; den Strom dafür lieferte ein Dieselaggregat. Im November 1925 ließ er seine Erfindung patentieren.
Die "Buckau", inzwischen in "Baden-Baden" umbenannt, ließ Anton Flettner im Frühjahr 1926 zu Werbezwecken über den Atlantik in die USA fahren. Auch gründete er die "Flettner-Rotor-Schifffahrt GmbH", um seine Erfindung zu vermarkten. Mit der "Barbara" entstand bald ein zweites Rotorschiff, welches sogar drei Rotor-Segel hatte. Nachhaltiger Erfolg war ihm mit dieser Erfindung jedoch zunächst nicht vergönnt.
Zeitgleich experimentierte er mit rotorbetriebenen Windkrafträdern, gründete 1925 gar die "Flettner Windturbine GmbH". Durchsetzen konnte sich diese Idee allerdings nicht.
Viele weitere Erfindungen Flettners folgten, so etwa ein Lüfter.
Weltruhm erlangte er jedoch für sein Wirken im Bereich der Luftfahrt.

DER "KOLIBRI"
und Tragschraubern).
Wieder war es das Militär, welches auf sein Wirken aufmerk-
sam wurde. Nach zahlreichen Testläufen, konnte der erste deutsche Hubschrauber im Jahr 1935 erfolgreich getestet werden. Das Oberkommando der Kriegsmarine beauftragte Flettner sodann mit dem Bau von Bordhubschraubern zum Einsatz auf Kriegsschiffen. Zu diesem Zwecke gründete er in Berlin die "Anton Flettner GmbH". Vor allem in Zusammen-
arbeit mit seinem Berater, dem Luftfahrtingenieur Kurt Hohenemser, entstanden in der Folgezeit weitere Hubschrauber-Modelle.
Nach zahlreichen Versuchen und Rückschlägen gelang 1942 schließlich die Konstruktion des "Fl 282 – Kolibri", welcher
für seine gegenläufig drehenden Rotoren berühmt wurde.
Er konnte eine Flughöhe von etwa 4.000 Metern und eine Geschwindigkeit von rund 160 Stundenkilometer erreichen. Der "Kolibri" sollte der erste serienmäßig produzierte Hubschrauber der Welt werden.
Das Fortschreiten des Krieges verhinderte, dass eine in der Folge beauftragte "Kolibri"-Serie fertiggestellt werden konnte. Alliierte Bomber zerstörten die Produktionsstätten; man verlegte den Bau zwischenzeitlich nach Schweidnitz.
Gegen Kriegsende floh Anton Flettner von hier aus vor den herannahenden russischen Truppen nach Bad Tölz, wo er kurzzeitig inhaftiert wurde.
TESTFLUG "KOLIBRI"1942
EMIGRATION IN DIE USA
EMIGRATION IN DIE USA

Wie anderen Wissen-
schaftlern in jener Zeit auch, wurde es Anton Flettner nach dem Krieg ermöglicht, in die USA einzuwandern („Operat-
ion Paperclip“). Mindes-
tens ein aus den ehema-
ligen Produktions-
betrieben mitgenom-
mener Hubschrauber gelangte auf diese
Weise in den Besitz
des amerikanischen Militärs. 1947 reiste Flettner ein – bereits
1952 erhielt er die
amerikanische
Staatsbürgerschaft.
In den Vereinigten Staaten wurde Anton Flettner zunächst Chefkonstrukteur bei der Firma Kamann. 1949 gründete er in der Nähe von New York die "Flettners Aircraft Corporation", welche sich der Forschung und Konstruktion von Hubschraubern und Raketenwaffen widmete.
Flettner war schließlich auch an der Helikopterforschung der
US-Army beteiligt.
Im Jahr 1960 kehrte Flettner mit seiner Ehefrau noch einmal für
einen kurzen Besuch nach Deutschland zurück. In der Frankfurter Leonhardskirche feierte das Paar seine Goldene Hochzeit.
Anton Flettner starb am 29. Dezember 1961 in New York. Bestattet wurde er in Eddersheim.

FRANKFURT AM MAINGOLDENE HOCHZEIT 1960
WIRKEN UND REZEPTION
Eddersheim ernannt worden. Das Grabmal der Familie
steht – wie die "Flettner-Villa" – unter Denkmalschutz.
Auch eine Straße am Ort wurde nach ihm benannt.
Heute ist der "Flettner-Rotor" in Zeiten des Klimawandels
als umweltfreundlicher Schiffsantrieb wieder Thema der Forschung.
Natürlich muss Anton Flettner aber auch als Person seiner Zeit und vor allem auch in seinem Verhältnis zum Militär
in den unterschiedlichen politischen Systemen betrachtet werden. Hier zeichnet sich ein ambivalentes Bild, insbe-
sondere durch seine Nähe zum NS-Regime. Über seine politische Haltung weiß man nur wenig – jedoch arbeitete
er stets eng mit dem Militär zusammen. Eine von ihm nach dem Kriegsende aufgestellte Behauptung, er selbst sei nach 1933 aufgrund seiner Ehe mit einer "Halbjüdin" verfolgt worden, scheint unwahrscheinlich. Gleichzeitig beschäftigte
er jedoch mit dem Luftfahrtingenieur Kurt Hohenemser einen jüdischen Wissenschaftler in Berlin, wodurch dieser bis zum Ende des Krieges unter Flettners Schutz stand.
Sah sich Anton Flettner allein als Erfinder, der seine Projekte umsetzen wollte? War es ihm gleich, wer auf welche Art und Weise seine Erfindungen nutzte? All diese Fragen müssen an dieser Stelle unbeantwortet bleiben. Sicher ist nur, dass Person und Schaffen Flettners dem Grundsatz einer komplexen und kritischen Betrachtungsweise
unterliegen sollte.
NATIONALSOZIALISMUS UND ZWEITER WELTKRIEG
NATIONALSOZIALISMUS UND ZWEITER WELTKRIEG
Aufmarsch in Hattersheim zum 1. Mai, 1930er Jahre.
"MACHTERGREIFUNG" UND ERSTE JAHRE
"MACHTERGREIFUNG" UND ERSTE JAHRE
Wie andernorts auch, bestimmten nun die Maßnahmen des Regimes zum Aufbau der Diktatur den Alltag am Ort – auch in den Kommunen sollte das "Führerprinzip" umgesetzt werden. Die demokratischen Grundprinzipien
und Freiheiten wurden außer Kraft gesetzt, politische Gegner eingeschüchtert und ausgeschaltet, ein Terrorapparat aufgebaut. Das soziale, politische, das wirtschaftliche und auch das kulturelle Leben wurde "gleichgeschaltet" und durch den NS-Apparat vereinnahmt.
Während in größeren Städten der Verwaltungsapparat oft größtenteils ausgetauscht wurde, verzichtete man in kleineren Orten manchmal auf
diese Maßnahmen und beließ "unpolitische" Personen im Amt. So auch
in Eddersheim, wo seit dem Jahr 1924 Heinrich Josef Jost das Amt des Bürgermeisters bekleidete. Obwohl dem katholischen Milieu zugehörig
und nicht Mitglied der Partei, begnügte man sich hier mit der Kontrolle
des Amtsträgers durch die NSDAP.
Eine eigene Ortsgruppe wurde in Eddersheim vergleichsweise spät –
im April 1934 – gegründet. Laut Volkszählung im Jahr 1939 waren von
1.607 Einwohnerinnen und Einwohnern in Eddersheim 94 Mitglied der Partei. NSDAP-Ortsgruppenleiter war von Beginn an Lorenz Kesting, welcher seit Mai 1933 zudem als Gemeinderat tätig war. Kesting soll sein Amt eher zurück-
haltend ausgeübt haben – das Verhältnis zum Bürgermeister scheint recht konfliktarm gewesen zu sein.
Konfliktreicher soll sich die Beziehung zwischen Regimegetreuen und
dem Eddersheimer Pfarrer Josef Schneider gestaltet haben. Nachdem
das Abhalten des Religionsunterrichts an der Schule verboten worden war, richtete Schneider beispielsweise über der Sakristei einen eigenen Schulraum ein. Zudem wurde wohl seine Privatbibliothek durchsucht und er selbst mehrfach zu Vernehmungen einbestellt. Zugleich lebten auch die anderen Katholikinnen und Katholiken am Ort ihr religiöse Leben weiter aus.
So trafen sich beispielsweise einige katholische Männer Eddersheims monatlich im Gasthaus "Zum Schwanen" – 1942 Verbot die Gestapo
diese Zusammenkünfte.
Eine aktive Widerstandsbewegung, wie es sie etwa in Hattersheim und Okriftel aus dem sozialdemokratischen und kommunistischen Wirkungskreis gegeben hat, ist für Eddersheim nicht bekannt.
GESCHICHTE DES JÜDISCHEN LEBENS IN HATTERSHEIMMIT EDDERSHEIM UND OKRIFTEL

Weiterführende Informationen zur Geschichte des jüdischen Lebens in Hattersheim mit den Stadtteilen Eddersheim und Okriftel sowie speziell zu den Ereignissen rund um den Novemberpogrom 1938 finden sich hier:
URSPRÜNGE JÜDISCHEN LEBENS IN EDDERSHEIM
URSPRÜNGE JÜDISCHEN LEBENS IN EDDERSHEIM

Erste Spuren jüdischen Lebens in Eddersheim reichen bis in das
17. Jahrhundert zurück. Für das Jahr
1694 ist bekannt, dass
hier vier jüdische Familien lebten. Die Familien Klein und Hahn wohnten bei-
spielsweise über mehrere Generationen im Dorf am Main.
Die in Eddersheim ansässigen Jüdinnen
und Juden gehörten
zur jüdischen Gemeinde
in Flörsheim, welche 1843 mit Wicker und Weilbach
zur Israelitischen Kultusgemeinde Flörsheim zusam-
mengefasst wurde.
Aufgrund der räumlichen Nähe zu Okriftel baten die in Eddersheim
lebenden Jüdinnen und Juden immer wieder darum, sich der dortigen Gemeinde anschließen zu dürfen. Doch nur vereinzelt wurde es Schülerinnen und Schülern erlaubt, von einem Lehrer aus Okriftel unterrichtet zu werden.
Das ehemalige jüdische Schlachthaus, ein Gebäude aus dem
18. Jahrhundert, steht in Eddersheim bis heute.

VERFOLGUNG UND ENTRECHTUNG
die in Hattersheim und Okriftel – war und blieb klein.
1933 lebten in Eddersheim elf Personen, welche nach nationalsozialistischer Definition als Jüdinnen und
Juden galten.
Nach der "Machtergreifung" hatten sie natürlich auch
unter der fortschreitenden Diskriminierung, Entrechtung
und Verfolgung zu leiden. Wie andernorts auch, so wurde
das Jahr 1938 für die jüdische Gemeinschaft in Eddersheim
zu einem Wendepunkt.
Vor allem der Novemberpogrom wurde zur Zäsur.
Die gewaltsamen Übergriffe gegen die hier noch ansässigen Jüdinnen und Juden begannen in den Abendstunden des
10. Novembers. Unter anderem wurde auch die Familie Klein Opfer der Ausschreitungen.
Ihr Schicksal soll hier beispielhaft geschildert werden.
DAS SCHICKSAL DER FAMILIE KLEIN
seiner Ehefrau Rosa, der Tochter Alice Frohwein und dem Enkel Arnold in der Eddersheimer Bahnhofstraße.
Ein Mob zerstörte am Abend des 10. Novembers die Fenster, die Rollläden und das Mobiliar des Wohnhauses. Zudem wurden wohl Silberbestecke und Leuchter geraubt. Ein SA-Mann soll einen Schrank mit einer Axt zerschlagen haben – Julius Klein soll misshandelt worden sein.
Später schilderte Alice Frohwein die folgenden Ereignisse:
"Ich flüchtete mit meinem Jungen in eine Scheune und verblieb dort eine Nacht in der ständigen Angst vor weiteren Verfolgungen." Sie selbst erinnerte sich später, "dass im Haus meiner Eltern praktisch kein Stück mehr ganz war, dass auch Türen und Fenster zerstört waren. […] [Ich] kann über diese Ereignisse in der sogen. Kristallnacht nur sagen, dass – nachdem ich alles sah – mich das Grauen gepackt hat. […] Ich erinnere mich heute noch, dass ich einige Kleider hoffte aus den Trümmern für mich retten zu können – auch das eine oder andere Schmuckstück und bares Geld von dem ich wusste, wo wir es aufbewahrt hatten. Selbst an diesem Vorhaben wurde ich durch die in meiner Wohnung wütenden Nazis gehindert […] und ich flüchtete nach Mainz, wo Angehörige meines Mannes wohnten. Die Wohnung habe ich nicht mehr betreten und bin von Mainz aus direkt nach Köln gefahren und von Köln aus ausgewandert."
Allein eine Anwohnerin soll an diesem Abend gegen die Täter im Hause Klein vorgegangen sein.
DAS ENDE DER JÜDISCHEN GEMEINSCHAFT
DAS ENDE DER JÜDISCHEN GEMEINSCHAFT
"Sämtliche jüdischen Familien haben Eddersheim verlassen […]."
In der Folge lebte ein Großteil der Eddersheimer Jüdinnen und Juden in Frankfurt am Main. Nur zweien gelang die Flucht in die USA, drei starben in Theresienstadt, eine Eddersheimer Jüdin starb noch in Frankfurt, eine andere starb im Zuge ihrer Deportation "nach Osten".
Julius und Rosa Klein mussten in Frankfurt in ein sogenanntes "Judenhaus" ziehen. Im Oktober 1941 wurden sie von dort aus in das Ghetto Lodz deportiert, wo sie im April 1942 starben. Alice Frohwein gelang im Dezember 1938 mit ihren Kindern die Flucht nach Belgien.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lebten in Eddersheim keine Jüdinnen und Juden mehr.
OPFER DER "EUTHANASIE"
OPFER DER "EUTHANASIE"


Neben den Opfern
unter den Eddersheimer Jüdinnen und Juden gab es auch mindestens
zwei der sogenannten "T4-Aktion" am Ort.
Jakob Reuter
Jakob Reuter kam im Jahre 1904 als eines
von neun Kindern des Ehepaares Heinrich und Christina Reuter zur Welt. Er durchlief eine reguläre Schulbildung in der Eddersheimer Elemen-
tarschule, wobei in
seinen Zeugnissen vermerkt wurde, dass
er unter körperlichen
und geistigen Ein-
schränkungen litt.
Jakob Reuter war nach dem Ende der Schulzeit als Arbeiter tätig - insbesondere in der Landwirtschaft.
Es ist nicht bekannt, unter welchen Umständen er schließlich in die Landesheilanstalt Weilmünster eingeliefert worden ist. Laut der Dokumentation des dortigen Standesamtes starb er im August 1941 an "Körperzerfall bei Schizophrenie"; ein Euphemismus für den Krankenmord
in der Anstalt.
Anna Luise Eigner
1902 in Eddersheim geboren, lebte Anna Luise Eigner gemeinsam mit ihren Eltern und ihren beiden Geschwistern in der Eddersheimer Bahnhofstraße. Nach dem Ende ihrer Schullaufbahn absolvierte sie eine Ausbildung zur Sekretärin und arbeitete fortan bei den Farbwerken Hoechst.
Das Scheitern einer Beziehung soll zu einer psychischen Erkrankung geführt haben. Mit dieser Diagnose wurde sie 1939 in die Landesheilanstalt Herborn eingeliefert. Im Mai 1941 verbrachte man sie in die Heilanstalt in Hadamar, wo sie vermutlich noch am Tag der Ankunft in der Gaskammer ermordet wurde.

KRIEGSGEFANGENE UND ZWANGSARBEIT
KRIEGSGEFANGENE UND ZWANGSARBEIT
Die Quellen bezüglich dieses Themenkomplexes sind Eddersheim betreffend widersprüchlich. So soll es in der Gaststätte "Zum Taunus" etwa ein Lager für Zwangsarbeitende der Reichsbahn gegeben haben. Ab 1942 wurden hier vermutlich 100 russische Männer, im Jahr darauf zusätzlich 53 Frauen untergebracht. Das Lager soll bis 1945 bestanden haben.
Recherchen belgischer Behörden zufolge soll in Eddersheim allerdings bereits seit 1940 ein Lager für russische, ukrainische, litauische und polnische Männern gegeben haben. Die Pfarrchronik berichtet hierzu,
dass Pfarrer Schneider für etwa 20 bis 25 Polen am Ort eigene Gottesdienste abgehalten habe. Auch dieses Lager soll bis 1945 existiert haben.
Dieser Widerspruch lässt sich nach dem derzeitigen Forschungsstand nicht aufklären; vielleicht hat es während des Krieges auch zwei Arbeitslager gegeben.
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der ausländischen Arbeitskräfte wurde vor allem durch deren Herkunft bestimmt. Allen gemein war, dass sie kaum Rechte hatten und unter schlechten Bedingungen ihre Arbeit verrichten mussten. Laut den lückenhaft überlieferten Unterlagen der Frankfurter Gestapo waren in Eddersheim zudem 28 Polen, Litauer und Russen
von der Verfolgung durch die Geheime Staatspolizei betroffen.
Ein Beispiel ist das Schicksal des 20-jährigem Litauers Alexander Kuleszka. Er war im März 1942 aus dem Eddersheimer Lager der Reichsbahn geflüchtet. Zwei Monate später hatte man ihn ergriffen, verhaftet und im Arbeits-erziehungslager in Frankfurt-Heddernheim inhaftiert. Wegen Entkräftung wurde der alsbald in das Strafgefängnis Frankfurt-Preungesheim verlegt
wo er kurze Zeit später verstarb.
KRIEGSENDE
Im März 1942 mussten beispielsweise erneut drei Glocken der Kirche abgeliefert werden.
Viele gravierender war sicher ein Bombenabwurf am Abend des 22. März 1944. Das Pfarrhaus wurde hierbei schwer beschädigt, die Schwester des Pfarrers, welche zu Besuch in Eddersheim war, kam dabei ums Leben.
Die Kampfhandlungen des Zweiten Weltkriegs endeten für die Menschen zwischen Frankfurt und Wiesbaden Ende März 1945 - beinahe sechs Wochen vor der Kapitulation am 8. Mai.
Amerikanische Truppen besetzten beiden Städte und brachten die Region unter ihre Kontrolle.
Neben den Opfern von Holocaust und "Euthanasie" sowie den andernorts aufgrund der Kriegseinwirkungen gestorbenen Zivilisten, beklagte man in Eddersheim auch den Tod von 95 Soldaten, welche kriegsbedingt ihr Leben verloren hatten.
AUFARBEITUNG UND ERINNERUNG

Verfolgung wurden in Hattersheim am Main ab dem Jahre 2010 insgesamt 81 sogenannte Stolpersteine gesetzt,
19 davon in Eddersheim.
Die Stadtverwaltung hatte sich damit an der Aktion
des Künstlers Gunter Demnig beteiligt, in deren
Rahmen bis heute mehr als 109.000 Steine in
vielen europäischen Ländern verlegt wurden.
Die Verlegung der Stolpersteine wurde in eine Reihe von Veranstaltungen und Projekten zur Aufarbeitung der
NS-Zeit in ganz Hattersheim eingebettet. 2008 gab es eine Ausstellung und einen internationalen Jugendworkshop.
Auch die Heinrich-Böll-Schule hat sich in vielfältiger Weise
mit diesen Geschehnissen beschäftigt.
In diesem Kontext ist auch die wissenschaftliche Erforschung der NS-Zeit in Hattersheim durch die Historikerin Anna Schmidt erfolgt. Die Ergebnisse ihrer Arbeit sind in der Publikation "Hattersheim, Eddersheim, Okriftel im National-
sozialismus - Diktatur, Widerstand, Verfolgung 1933-1945" veröffentlicht worden.
Die Biographien der Opfer der NS-Diktatur sind in dem 2014 erschienenen Buch " '…man müßte einer späteren Generation Bericht geben.' Ein Lesebuch zur Geschichte und Gegenwart von Hattersheim am Main" nachzulesen und können auch über die Homepage der Stadt Hattersheim am Main abgerufen werden.
Hier - wie in der Publikation - findet sich auch eine Dokumentation über die Okrifteler Sinti. Zur Erinnerung an deren Schicksal ist 2018 in Okriftel ein Mahnmal errichtet worden.
NACHKRIEGSZEIT UND WIEDERAUFBAU
NACHKRIEGSZEIT UND WIEDERAUFBAU DIE ERSTEN JAHRE
NACHKRIEGSZEIT UND WIEDERAUFBAU DIE ERSTEN JAHRE

den Kriegsschäden, dem Mangel an Lebensmitteln und anderen Versorgungsgütern, waren die Wohnungsnot und die Integration der
von Flucht und Vertreibung Betroffenen beziehungsweise der Umgang
mit Displaced Persons die bestimmenden Themen in jenen Jahren.
Die schwierigen Lebensbedingungen bestimmten den Alltag der
Menschen - auch in Eddersheim. Betroffen war beispielsweise der Schulbetrieb. Zwar hatte man den Unterricht für 273 Kinder zum
1. Oktober 1945 wiederaufnehmen können, doch litten viele Schülerinnen
und Schüler an Unter- und Mangelernährung. Noch bis in das Jahr 1951 fanden daher Schulspeisungen statt. Im Winter 1947 verlegte man das Ende der Weihnachtsferien auf den 21. Januar, um im Januar einen größeren
Teil der Heizkosten zu sparen.
Eine besonders große Herausforderung stellte das massive Bevölkerungs-
wachstum dar. Waren im Jahre 1939 noch 1.604 Menschen am Ort gemeldet, so stieg deren Anzahl bis 1946 auf 2.095; 1956 lebten bereits 2.468 Personen in Eddersheim – 1967 waren es ganze 4.169. Ein Großteil der in Eddersheim aufgenommenen Zwangsmigrantinnen und -migranten stammten aus Ungarn und dem Sudetenland. Es wurde zu einer Art Hochburg der Vertriebenen und besaß zwischenzeitlich sogar den mitgliederstärksten Ortsverband des "Bundes der Vertriebenen" im Main-Taunus-Kreis.

GEMEINDEVERWALTUNG UND WAHLVERHALTEN
strukturen aufgebaut werden.
Zum 1. Juni 1945 hatte man Franz Otto als Bürgermeister für Eddersheim eingesetzt, ihn jedoch bald durch Josef Schmitten ersetzt. Zu Beginn des Jahres fanden die ersten Kommunal-
wahlen nach dem Ende der NS-Diktatur statt. Dem katho-
lischen Milieu Eddersheims entsprechend, ging die CDU als Sieger hervor. Im gleichen Jahr übernahm der Christdemokrat Heinrich Frank das Amt des Bürgermeisters.
1952 wurde schließlich Johann Kirchhof (Bild rechts) zum Bürgermeister gewählt - er war die letzte Person, welche dieses Amt vor der Hessischen Gebietsreform bekleiden sollte.
AUFSCHWUNG UND AUFBAU
AUFSCHWUNG UND AUFBAU


Ausbau sowie die Förderung von Wirtschaft und Wohnen, von sozialen Hilfsmaßnahmen, von Bildung, Kultur und Verkehr beschlossen und erfolgreich umgesetzt.
Auch in Eddersheim erlebte man bald eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, des Wohnungsbaus und des umfassenden Ausbaus
der Infrastruktur. Die Einwohnerzahlen stiegen immer weiter, der soziale Wohnungsbau und die Umsetzung zahlreicher Infrastrukturmaßnahmen veränderten das Gesicht der Gemeinde.
Nach und nach wurde der Ortskern Eddersheims von Neubaugebieten eingerahmt. Es entstanden dabei vor allem kleinere Wohneinheiten
und kaum größere Mehrfamilienhäuser - hatten sich doch auch die
Ansprüche an ein modernes Wohnen gewandelt. Diese Baummaß-
nahmen gingen somit auch mit einer gewissen Abwanderung aus
dem alten Ortskern einher.
Neben der Schaffung von Wohnraum wurden nun zahlreiche weitere Bauvorhaben und Infrastrukturmaßnahmen realisiert. Bereits im August
1949 hatte die Kirche ein neues Geläut erhalten, 1949/ 1950 wurde zudem
das katholische Pfarrhaus wieder aufgebaut. 1956 konnte der neue Sportplatz am Mainufer eingeweiht werden; 1958 öffnete der Katholische Kindergarten erstmals seine Türen. Im Jahr 1962 erhielt die Feuerwehr ein neues Spritzenhaus und der Friedhof wurde erweitert. 1964 entstand mit dem Katholischen Schwesternhaus ein Sozialzentrum mit ambulanter Kranken-
pflegestation. Ebenfalls im Jahr 1964 eröffnete die Kirchengemeinde eine erste Bücherei am Ort.
1966 entstand schließlich die Wohnanlage "Neue Heimat".
Einher gingen all diese Bauunterfangen mit dem Ausbau der Kanalisation sowie des Straßenwesens. Und nicht zuletzt wurden im Zuge dieser Expansionsphase, wie an anderer Stelle erwähnt, die Eddersheimer
Schule erweitert (Neubau: 1973) und bis 1963 die Evangelische Kirche errichtet.

STRUKTURWANDEL
in Eddersheim, wie andernorts auch, der Strukturwandel.
Die Landwirtschaft am Ort verzeichnete in der folgenden
Zeit einen kontinuierlichen Rückgang.
Eddersheim wurde zu einem klassischen Wohnort für Arbeitspendlerinnen und -pendler. Beschäftigt waren die Eddersheimerinnen und Eddersheimer weiterhin vor allem
in Frankfurt, Hattersheim, Rüsselsheim und Okriftel.
Die ersten der in Eddersheim ansässigen sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter stammten vor allem aus Griechenland, der Türkei und aus Nordafrika.
Als Arbeitgeber fungierte auch die 1962 auf der gegenüberliegenden Mainseite entstandene Caltex-Raffinerie. Die durch diese Industrieansiedlung verursachte Geruchs- und Geräuschbelästigungen, beeinflussten die Wohnqualität in Eddersheim fortan erheblich.
HESSISCHE GEBIETSREFORM
HESSISCHE GEBIETSREFORM

die zunehmende Komplexität und Mobilität von Staat und Gesellschaft, die fortschreitende Trennung zwischen Arbeits- und Privatsphäre, ein neues Freizeit- und Konsumverhalten, aber auch regionale Anforderungen stellten die Behörden in Gemeinden und Städten vor große Herausforderungen.
Vor diesem Hintergrund war ein Umbau der Verwaltungs-
strukturen und mit diesem eine Gebietsreform unabdingbar. Man zielte dabei vor allem auf die Optimierung der Verwaltungskraft der Kreise und Gemeinden, aber auch
auf die Schaffung und Verbesserung urbaner Lebensqualität
in suburbanen Räumen.
Die hierzu nötigen Reformprozesse verliefen etappenweise. Umgesetzt wurde die Gebietsreform insbesondere ab 1970 mit einer ersten Phase freiwilliger Zusammenschlüsse. Es schloss sich eine Neugliederung auf Kreis- und Gemeinde-
ebene an.
Weiterführende Informationen zur Gebietsreform und zum Freiwilligen Zusammenschluss von Hattersheim, Eddersheim und Okriftel finden sich hier:
DER HATTERSHEIMER ZUSAMMENSCHLUSS
DER HATTERSHEIMER ZUSAMMENSCHLUSS

SICHERUNG DER EIGENSTÄNDIGKEIT
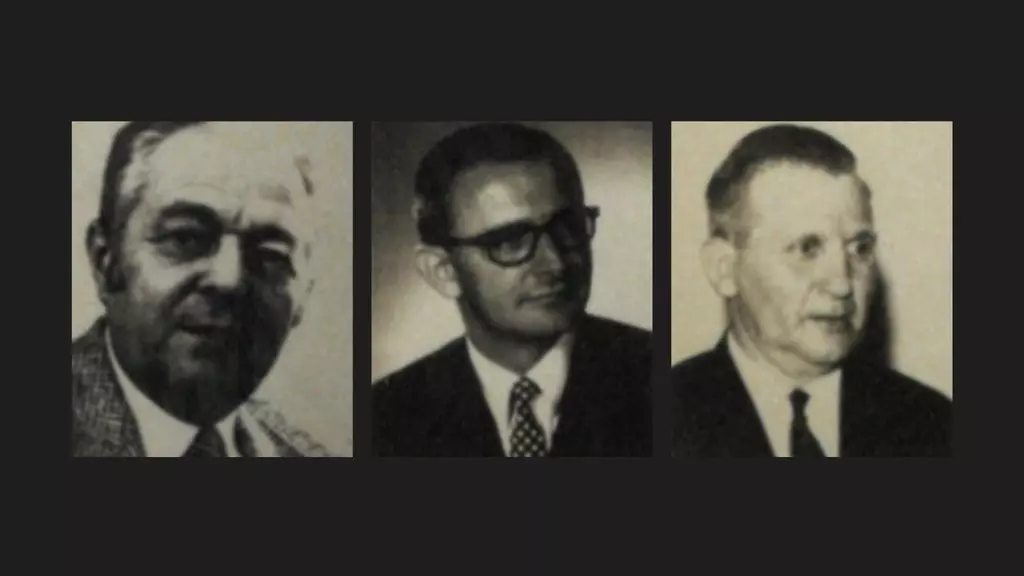
Frankfurt und Wiesbaden hatten Pläne, die darauf hinausliefen, praktisch den gesamten Main-Taunus-Kreis unter sich aufzuteilen. Die Stadt Frankfurt, die neben Eschborn vor allem auch die Flughafengemeinden eingliedern wollte, strebte danach, Hattersheim und Okriftel dem Stadtgebiet hinzuzufügen, um auf diese Weise ein zusammenhängendes Verwaltungsgebiet zu schaffen.
Hattersheims 1970 mit Erfolg gekröntes Streben danach, zur Stadt erhoben zu werden, ist nicht zuletzt auch vor diesem Hintergrund zu verstehen. In
den meisten Orten fürchtete man, als kleiner Teil einer großen Stadt eigene Interessen kaum durchsetzen zu können. Indes wurde sogar das Weiter-
bestehen des Main-Taunus-Kreises in Zweifel gezogen.
In Eddersheim fühlte man sich traditionell eher Flörsheim zugehörig.
Dort gab es zugleich Diskussionen um die Zukunft von Wicker und Weilbach. Zwischenzeitlich eruierte man in Eddersheim auch, ob nicht ein Zweier-
bündnis mit Okriftel in Frage kommen könnte, wobei man erkannte, dass dieser neue Ort und Hattersheim jeder für sich alleine wohl nicht genug Eigengewicht gehabt hätte, um sich weiteren Eingemeindungsbestrebungen zu widersetzen.
Der Entschluss, ein Dreierbündnis einzugehen, war schließlich eine Vernunftentscheidung, ein Kompromiss, der die Selbständigkeit der Kommune langfristig sicherte.
Am 1. Juli 1972 schlossen sich Hattersheim, Eddersheim und Okriftel zur Stadt Hattersheim zusammen. Man entschied sich dabei bewusst gegen eine eher herabsetzend wirkende Eingemeindung. Mit dem Zusatz "am Main", den die Stadt offiziell erst seit dem 1. Januar 1978 führen darf, trug man der Lage von Okriftel und Eddersheim Rechnung.
Der Entschluss zum Bau der neuen Eddersheimer Grundschule kann als Zugeständnis gewertet werden, welches den Zusammenschluss "erträglicher" machen sollte; so übrigens auch in Wicker und Brehmtal geschehen. Johann Kirchhof wurde bis zu seinem baldigen Wechsel in den Ruhestand Stadtrat in Hattersheim.
Im Main-Taunus-Kreis sind im Zuge der Gebietsreform aus ursprünglich
49 Städten und Gemeinden neun Städte und drei Gemeinden geworden.
Die endgültige Lösung Hattersheims von Frankfurt wurde mit der Ernennung Hofheims zur Kreisstadt zum 1. Januar 1980 vollzogen.

ZUSAMMENFÜHRUNG UND WEITERE ENTWICKLUNG
einig, dass man nicht über die Identifizierung der Bürger
mit ihrem jeweiligen Stadtteil hinweggehen sollte.
So gab es keine Überlegungen, die Feuerwehren zu zentralisieren, und schnell wurde die Idee fallen gelassen,
ein neues Stadtzentrum im geografischen Mittelpunkt zu schaffen. Es blieb bei den bestehenden Ortsgerichts- und Jagdbezirken. Eddersheim behielt auch weiterhin (und
bis heute) die Flörsheimer Vorwahl.
In Eddersheim und Okriftel wurden Verwaltungsstellen eingerichtet, deren Ämter jedoch sukzessive in der
Kernstadt zentralisiert und weiter professionalisiert wurden. Wichtige gemeinsame Infrastrukturprojekte konnten nunmehr realisiert werden.
Über all den mit und nach der Fusion angestoßenen wie umgesetzten Projekten und Maßnahmen lag bald ein zunehmend großer Schatten. Die 1970er Jahre gelten gemeinhin als ein Jahrzehnt der Transformationen.
Diese Umbrüche geschahen auf politischer, wirtschaftlicher, aber auch auf gesellschaftlicher und kultureller Ebene. Ausdruck, Ursache wie Folge waren die zahlreichen innen-
und außenpolitischen Krisen jener Jahre, wie etwa die erste einschneidende Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit oder der Übergang zur postindustriellen Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft. Arbeitslosigkeit und eine Überforderung der Sozialsysteme waren die Folge. Auch die Entstehung eines neuen Umweltbewusstseins fiel in jene Zeit.
All diese tiefgreifenden Änderungen erfassten natürlich auch die neu zusammengeschlossene Stadt Hattersheim am Main. Vor allem der fortgesetzte Strukturwandel traf die Kommune hart. Anfangs sah man die lokale Industrie und
das Gewerbe noch im Aufwind und förderte diese tatkräftig. Alsbald folgte jedoch eine große Schließungswelle von Unternehmen: Bereits 1970 hatte die traditionsreiche Okrifteler Papier- und Cellulosefabrik/ PHRIX ihre Pforten geschlossen; Anfang der 1980er Jahre wurde die Caltex-Raffinerie (Raunheim) stillgelegt.
Diese Entwicklung sollte in den folgenden Jahren
noch fortschreiten.
DORFERNEUERUNG
DORFERNEUERUNG PREKÄRE VERHÄLTNISSE IN DER ORTSMITTE
DORFERNEUERUNG PREKÄRE VERHÄLTNISSE IN DER ORTSMITTE


bereits im Jahre 1971 begonnen. Neben der Verbesserung der Verkehrs-
situation standen hierbei vor allem die Beseitigung baulicher Mängel sowie die Neugliederung von ungünstigen Grundstücksverhältnissen im Altstadt-
kern im Fokus. In Okriftel wurde ab Mitte der 1980er Jahre im Rahmen
eines Stadterneuerungsprogramms der alte Ortskern saniert.
In Eddersheim waren die ehemaligen Fischerviertel im Zentrum des Ortes aufgrund der Veränderung des dörflichen Lebensraumes nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges, des fortschreitenden Strukturwandels sowie der veränderten Ansprüche an eine moderne Wohnsituation zunehmend
dem Verfall ausgesetzt. Neben Baumängeln waren auch infrastrukturelle sowie sozialstrukturelle Defizite gegeben.
Vor allem auch die Auswirkungen des Betriebs der Caltex-Raffinerie
führten dazu, dass die Lebensqualität am Ort deutlich eingeschränkt
war. Im Januar 1966 hatte sich hier beispielsweise ein verheerender Unfall ereignet, eine große Explosion, welche das Leben von (vermutlich) fünf Personen gekostet und in Eddersheim durch die Druckwelle Dächer und Fensterscheiben beschädigt hatte.

ENTWICKLUNG EINES SANIERUNGSKONZEPTES
sozial- und infrastrukturellen Erneuerung im Rahmen des hessischen Landesprogramms zur Dorferneuerung zur Förderung angemeldet - im April 1983 konnte mit der Umsetzung des Projektes begonnen werden.
Während man in Hattersheim im Zuge der Ortskernsanierung die alte, gewachsene Gebäudestruktur und Bausubstanz
noch großflächig abreißen und umgestalten ließ, ging man
in Eddersheim wesentlich behutsamer vor. Das hatte nicht zuletzt auch etwas mit dem Wandel des Zeitgeistes zu tun - man erkannte, dass gewachsene Orte erhaltungswürdig waren und Sanierung, Modernisierung und Infrastrukturausbau möglichst behutsam umgesetzt werden sollten.
BESTANDSAUFNAHME UND PLANUNG
BESTANDSAUFNAHME UND PLANUNG


In diesem Sinne wurde nun durch eine Studentengruppe
der Fachhochschule Wiesbaden eine zeichnerische und
fotografische Bestandsaufnahme des Ortskerns vorgenommen.
In der Folge wurde die Flörsheimer Planergruppe Hytrek, Thomas,
Weyell und Weyell mit der Erarbeitung eines Dorfentwicklungsplanes beauftragt. Um die Bürgerinnen und Bürger Eddersheims an diesem Großprojekt zu beteiligen, wurde ein Dorfentwicklungsbeirat
eingerichtet. Zugleich entstand eine städtische Beratungsstelle
für Hauseigentümerinnen und -eigentümer. Man warb aktiv für
eine Beteiligung an der Dorferneuerung.
Das schließlich entstandene Dorferneuerungskonzept wurde
im Dezember 1984 von der Stadtverordnetenversammlung
verabschiedet und im Jahr darauf durch einen Rahmenplan
konkretisiert.

NEUGESTALTUNG DES MAINUFERS
Zugleich begann man von Seiten der Stadt mit der Erneue-
rung der Straßen, was zu einer sichtbaren Aufwertung des öffentlichen Raumes führte.
Entscheidenden Einfluss für die Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität übte dann vor allem auch die Stilllegung der Caltex-Raffinerie im Jahre 1980 und der sich anschließende Rückbau des Komplexes aus.
BAU DES BEGEGNUNGSHAUSES
BAU DES BEGEGNUNGSHAUSES


Ein weiteres Vorzeige-
projekt war der Bau des Begegnungshauses ab Dezember 1986.
Das alte Eckgebäude Kreuz-/Propsteistraße wurde abgebrochen,
das Fachwerkhaus Propsteistraße 12 saniert. An der Rückseite wurde ein Saalbau errichtet.
Mit dem Begegnungshaus entstand ein neuer Ortsmittelpunkt und zugleich eine Versammlungsstätte für die Bürgerinnen und Bürger. Man richtete hier eine Außenstelle der Stadtverwaltung ein; ebenso Beratungsbüros. Der multi-
funktional zu nutzende Saal und ein Jugendclub ergänzten das Angebot.

PRIVATE SANIERUNGSMAßNAHMEN
zum Vorbild für viele private Baumaßnahmen.
Die Kommune unterstützte diese etwa durch weitere Beratungstätigkeit oder auch durch thermografische Untersuchungen der Häuser. Nicht zuletzt ermöglichten
die finanziellen Zuschüsse aus dem Landesprogramm die Realisierung der sich anschließenden Baumaßnahmen.
Insgesamt wurden im Zuge der Eddersheimer Dorfer-
neuerung bis in die 1990er Jahre hinein mehr als 60 private Maßnahmen durch Beratung und Zuschüsse in Höhe von knapp 1 Mio. DM unterstützt. Weitere 1,27 Mio. DM an Fördergeldern flossen in die Umsetzung der kommunalen Projekte.
Zahlreiche alte Fachwerkhäuser konnten im Zuge dieses Großprojektes denkmalschutzkonform saniert werden und erstrahlen seither in neuem Glanz. Der alte Ortskern wandelte sich von einem Problemviertel zu einem attraktiven Wohnquartier.
ENTWICKLUNG EDDERSHEIMS BIS HEUTE
ENTWICKLUNG EDDERSHEIMS BIS HEUTEEDDERSHEIM ALS WOHNORT
Der sanierte Ortskern, die denkmalgeschützte Staustufe, das anziehend gestaltete Mainufer aber auch die in unmittelbarer Nähe befindlichen Naherholungsmöglichkeiten, wie etwa der Regionalpark Rhein-Main, machen Eddersheim zu einem begehrten Wohnort.
In der ersten Zeit nach dem Freiwilligen Zusammenschluss wurde von Seiten der Stadtverwaltung eine Realisierung gemeinsamer Projekte forciert und eine städtische Infrastruktur auf- beziehungsweise ausgebaut; die Stadtverwaltung wurde weiter professionalisiert und sukzessive zentralisiert. Eine eigene Verwaltungsstelle in Eddersheim gibt es seit Ende der 1990er Jahre nicht mehr.
Die Bevölkerungszahlen stiegen nur noch mäßig: 1975 -
kurz nach dem Freiwilligen Zusammenschluss - lebten in Eddersheim 4.837 Personen. Bis 1985 ging die Einwohner-
zahl auf 4.655 zurück, um danach wieder etwas zu steigen.
Im Jahre 2005 waren 4.946 Personen in Eddersheim
gemeldet, 2024 immerhin 5.160.
BEWAHRUNG DER ORTSIDENTITÄTEDDERSHEIMER VEREINE
schaft am Ort gepflegt werden - das ist insbesondere auch dem Engagement der örtlichen Vereine zu verdanken.
Der "Vereinsring Eddersheim" zeichnet sich beispielsweise verantwortlich für eine der bedeutendsten Veranstaltungen am Ort: Seit 1983 findet jährlich im Spätsommer das "Eddersheimer Fischerfest" statt, welches Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region anzieht.
Überregional bekannt ist die Handballabteilung der im Jahr 1888 gegründeten "Turn- und Sportgemeinschaft Eddersheim" ("TSG Eddersheim 1888 e. V.").
Und auch der 1931 aus der Taufe gehobene Fußballverein
"FC Eddersheim" ist durchaus erfolgreich. 2024 wurde ein Multifunktionsgebäude als Vereinsheim mit öffentlichen Funktionen im Erdgeschoss erbaut, welches den Vereinssport am Ort gezielt fördern soll.
AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN
Noch viel mehr ist dies durch die Nähe zum Frankfurter Flughafen der Fall. Als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor ökonomisch für die gesamte Region ein wichtiger Standort-
faktor, sind die Eddersheimerinnen und Eddersheimer vor allem seit der Inbetriebnahme der Nordwest-Landebahn
einer starken Fluglärmbelastung ausgesetzt. Die kürzeste Entfernung der Landebahn zum Ortsrand beträgt nur 1,6 Kilometer.
Der Flughafen ist auch der Grund, warum im Südwesten
von Eddersheim fast keine Wohngebiete mehr ausgewiesen werden dürfen, wenngleich natürlich auch hier wie andernorts die Wohnraumnot ein bestimmendes Problem ist. Zusätzlicher Wohnraum kann hier vor allem durch Nachverdichtung geschaffen werden.
Ein anderes, wichtiges Thema für die Einwohnerinnen und Einwohner ist seit Jahren der Rückgang der lokalen Dienst-
leistungsinfrastruktur. Insbesondere das Fehlen eines Nahversorgungszentrums wird immer wieder beklagt.
Abhilfe soll durch den Bau eines solchen Komplexes am Ortsausgang in Richtung Okriftel geschaffen werden.
Darüber hinaus ist die Erweiterung der Kinderbetreuungs-
plätze seit einiger Zeit immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Hattersheims erste Naturkita wurde Anfang 2023 in Eddersheim eröffnet und soll bald erweitert werden.
In der Phase der Prüfung befinden sich zudem diverse Projekte die Verkehrsinfrastruktur betreffend. Durchgangsverkehr und Staus am beschrankten Bahnübergang sind ein großes Problem für die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Auch der durch die Deutsche Bahn geplante und noch nicht realisierte barrierefreie Umbau des Bahnhofes ist seit Jahren Anlass für öffentliche Aussprachen.
Aktuelle Herausforderungen in Eddersheim betreffen vor
allem auch die Anpassung an den Klimawandel sowie Maßnahmen des Klimaschutzes. Ein Beispiel hierfür ist die projektierte Maindeich-Rückverlegung zwischen Flörsheim und Eddersheim. So sollen sowohl die Bevölkerung als auch die landwirtschaftlichen Flächen vor starkem Hochwasser,
wie es statistisch gesehen alle 200 Jahre auftreten kann, geschützt werden. Wichtig ist hierbei vor allem die Schaffung von Retentionsräumen. Zudem soll im Zuge des Projektes
"100 wilde Bäche für Hessen" der Weilbach (auch: Kassernbach) renaturiert werden.
All diese Herausforderungen, vor denen Eddersheim heute steht, bieten auch Chancen für eine Weiterentwicklung
des ehemaligen Fischerdorfes. Die Menschen, die hier bereits seit Tausenden von Jahren siedeln, mussten sich stets an veränderte ökologische, gesellschaftliche wie politische Bedingungen anpassen und werden dies auch in Zukunft erfolgreich meistern.
















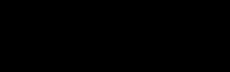












































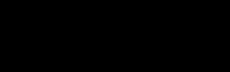




















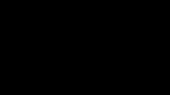












































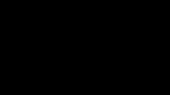











 EINFÜHRUNG
EINFÜHRUNG
 EDDERSHEIM
EDDERSHEIM
 ... JAHRE EDDERSHEIM
... JAHRE EDDERSHEIM
 ERSTERWÄHNUNG 1145
ERSTERWÄHNUNG 1145
 ERSTE SIEDLUNGSSPUREN
ERSTE SIEDLUNGSSPUREN
 EIN FRANKE NAMENS ETHER?
EIN FRANKE NAMENS ETHER?
 TERRITORIAL- UND HERRSCHAFTSGESCHICHTE
TERRITORIAL- UND HERRSCHAFTSGESCHICHTE
 MAINZER HERRSCHAFT SEIT DEM SPÄTMITTELALTER
MAINZER HERRSCHAFT SEIT DEM SPÄTMITTELALTER
 DAS 17. JAHRHUNDERT
DAS 17. JAHRHUNDERT
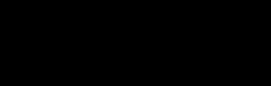 DER SCHWARZE TOD
DER SCHWARZE TOD
 HEXENVERFOLGUNG
HEXENVERFOLGUNG
 DAS LEBEN IM FISCHERDORF
DAS LEBEN IM FISCHERDORF
 HUGO GRAF VON ELTZ
HUGO GRAF VON ELTZ
 ZEUGNISSE DES WIRKENS DES DOMPROPSTES
ZEUGNISSE DES WIRKENS DES DOMPROPSTES
 CHRISTIANISIERUNG UND KIRCHENBAU
CHRISTIANISIERUNG UND KIRCHENBAU
 ERWEITERUNG DER KATHOLISCHEN KIRCHE
ERWEITERUNG DER KATHOLISCHEN KIRCHE
 DIE EVANGELISCHE KIRCHE
DIE EVANGELISCHE KIRCHE
 DIE ANFÄNGE DER EDDERSHEIMER SCHULE
DIE ANFÄNGE DER EDDERSHEIMER SCHULE
 DAS SCHULWESEN IM WANDEL
DAS SCHULWESEN IM WANDEL
 VOLKS- UND SCHÜLERBAD
VOLKS- UND SCHÜLERBAD
 DIE SCHULE AM WEIßEN STEIN
DIE SCHULE AM WEIßEN STEIN
 FORTSCHREITENDE INDUSTRIALISIERUNG
FORTSCHREITENDE INDUSTRIALISIERUNG
 EDDERSHEIM NACH DER JAHRHUNDERTWENDE
EDDERSHEIM NACH DER JAHRHUNDERTWENDE
 FLUSSSPERREN VERBESSERN SCHIFFBARKEIT
FLUSSSPERREN VERBESSERN SCHIFFBARKEIT
 BAU DER STAUSTUFE
BAU DER STAUSTUFE
 BAU DER STAUSTUFE
BAU DER STAUSTUFE
 KRAFTWERKBAU
KRAFTWERKBAU
 DIE STAUSTUFE HEUTE
DIE STAUSTUFE HEUTE
 ANTON FLETTNER
ANTON FLETTNER
 DER ERFINDER
DER ERFINDER
 DER "FLETTNER-ROTOR"
DER "FLETTNER-ROTOR"
 DER "KOLIBRI"
DER "KOLIBRI"
 TESTFLUG "KOLIBRI"
TESTFLUG "KOLIBRI"
 GOLDENE HOCHZEIT
GOLDENE HOCHZEIT
 WIRKEN UND REZEPTION
WIRKEN UND REZEPTION
 NATIONALSOZIALISMUS UND ZWEITER WELTKRIEG
NATIONALSOZIALISMUS UND ZWEITER WELTKRIEG
 GESCHICHTE DES JÜDISCHEN LEBENS IN HATTERSHEIM
GESCHICHTE DES JÜDISCHEN LEBENS IN HATTERSHEIM
 VERFOLGUNG UND ENTRECHTUNG
VERFOLGUNG UND ENTRECHTUNG
 DAS SCHICKSAL DER FAMILIE KLEIN
DAS SCHICKSAL DER FAMILIE KLEIN
 OPFER DER "EUTHANASIE"
OPFER DER "EUTHANASIE"
 KRIEGSENDE
KRIEGSENDE
 AUFARBEITUNG UND ERINNERUNG
AUFARBEITUNG UND ERINNERUNG
 GEMEINDEVERWALTUNG UND WAHLVERHALTEN
GEMEINDEVERWALTUNG UND WAHLVERHALTEN
 AUFSCHWUNG UND AUFBAU
AUFSCHWUNG UND AUFBAU
 STRUKTURWANDEL
STRUKTURWANDEL
 HESSISCHE GEBIETSREFORM
HESSISCHE GEBIETSREFORM
 DER HATTERSHEIMER ZUSAMMENSCHLUSS
DER HATTERSHEIMER ZUSAMMENSCHLUSS
 ZUSAMMENFÜHRUNG UND WEITERE ENTWICKLUNG
ZUSAMMENFÜHRUNG UND WEITERE ENTWICKLUNG
 DORFERNEUERUNG
DORFERNEUERUNG
 ENTWICKLUNG EINES SANIERUNGSKONZEPTES
ENTWICKLUNG EINES SANIERUNGSKONZEPTES
 BESTANDSAUFNAHME UND PLANUNG
BESTANDSAUFNAHME UND PLANUNG
 NEUGESTALTUNG DES MAINUFERS
NEUGESTALTUNG DES MAINUFERS
 BAU DES BEGEGNUNGSHAUSES
BAU DES BEGEGNUNGSHAUSES
 PRIVATE SANIERUNGSMAßNAHMEN
PRIVATE SANIERUNGSMAßNAHMEN
 EDDERSHEIMER DORFERNEUERUNG
EDDERSHEIMER DORFERNEUERUNG
 ENTWICKLUNG EDDERSHEIMS BIS HEUTE
ENTWICKLUNG EDDERSHEIMS BIS HEUTE
 BEWAHRUNG DER ORTSIDENTITÄT
BEWAHRUNG DER ORTSIDENTITÄT
 AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN
AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN
 ANHANG
ANHANG
 ANHANG
ANHANG
 ANHANG
ANHANG
 ANHANG
ANHANG
 ANHANG
ANHANG
 ANHANG
ANHANG
 ANHANG
ANHANG
 ANHANG
ANHANG